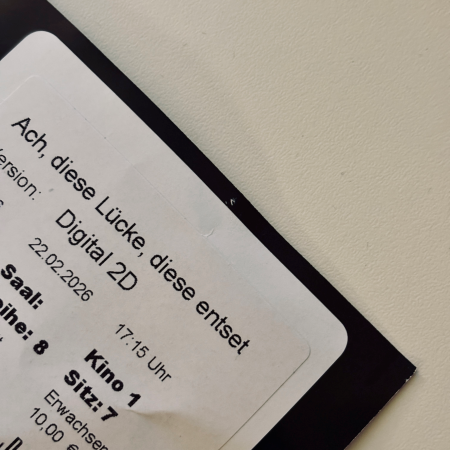Der Vorfrühling eskaliert hier weiter vollkommen ungehemmt, es ist eindeutig T-Shirt-Wetter. Man sieht nackte Haut an Armen und Beinen, man sieht tiefe Dekolletés an Damen und Maurern. Es kommt einem alles äußerst ungewohnt vor und etwa so, als wäre man verreist. Und zwar weit, weit, vielleicht einen alten Hannes-Wader-Song dabei pfeifend: „Ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer.“
Auf YouTube lese ich, dass dieser Song damals ein Beweismittel sein sollte in einer Diskussion zwischen Degenhardt und Wader. Degenhardt war der Ansicht, ein Liedtext brauche stets die guten alten Endreime. Wader wollte beweisen, dass es anders geht, und schrieb daraufhin dieses Lied. Hier in der Version von Johannes Strate, von dem ohnehin empfehlenswerten Album „Salut an Hannes Wader“.
Neben den leichtbekleideten, vorwärtsdenkenden oder wild hoffenden Passanten sieht man noch zahlreiche eher skeptische Menschen in dicken, meist schwarzen, aufgepufften Winterjacken, die sie stur weiterhin tragen. Weil es eben erst Februar ist, ne.
Im Laufe des Tages gleichen sich die Leiden der beiden so gegensätzlichen Gruppen gerecht aus: In der Sonne zergehen die Winterjackenträger, im Schatten frieren die Kurzbehosten. Was aber allen höchst diplomatisch geholfen hätte, das wiederum finden wir heute in den Lyrics bei Fortuna Ehrenfeld:
„The unpredictable beauty of Übergangsjäckchen”
Das ungewohnte Wetter verleitet ansonsten erstaunlich viele Menschen zu kleinen Änderungen im Tagesablauf. Was ich weiß, da ich auf dem routinemäßigen nachmittäglichen Weg zum Einkauf auf einmal praktisch alle Menschen treffe, die ich im Stadtteil mindestens auf Begrüßungsniveau kenne. Und wenig sind das nun nicht. Teils habe ich sie schon seit Monaten nicht gesehen, all diese Leute. Die haben zu dieser Stunde in den dunklen und kalten Monaten stets anderes gemacht, haben wahrscheinlich hinterm Ofen gesessen.
Einige der Namen habe ich prompt wieder vergessen, so lang war der Winter, so gründlich haben wir uns nicht mehr gesehen. Ihre Namen sind mir im Hirn zeitgleich mit dem Schnee verweht oder zerschmolzen.
Wie Erdmännchen, die vor ihren Höhlen posieren, so stehen wir nun jedenfalls auf einmal alle wieder vor unseren Häusern und Bauten. Sehen in den blauen Himmel, schnuppern herum, sind auf neue Art wachsam, beäugen interessiert die Futterstellen in der Außengastro. Vielleicht sind wir von Fall zu Fall nicht ganz so niedlich wie die Tiere im Zoo, ich neige dabei auch zur Selbstkritik, aber immerhin werden auch wir an diesem Tag manchmal von irgendwem freudig begrüßt, ähnlich wie Niedliches im Gehege: „Na, guck mal! Wer steht denn da!“
Winterschlafendrituale Und solche kleinen Freuden sind auch schön.




Auf dem Hoteldach gegenüber, ich sehe es schon am Morgen, weht wieder die Fahne, nein, pardon, die Flagge des Landes eines Hamburger Staatsgastes. Ich erkenne sie nicht, wie es leider öfter vorkommt. Diesmal ist es aber auch ein wenig peinlich, denn gleichmäßige Längstreifen in Blau, Schwarz und Weiß, die hätte man ruhig erkennen können, Herr Buddenbohm. Das ist nämlich Estland, das ist ein EU-Land, ein NATO-Land und außerdem ein Land in der Nähe, in Fährverbindungsentfernung. Na gut, mit Zwischenstopp in Finnland.
Die Flagge wirkt allerdings auf mich, als hätte ich sie noch nie gesehen. Es klingelt rein gar nichts bei diesem Anblick. Eigentlich könnte es für mich auch eine ausgedachte Flagge sein. Irgendwelche Farben eben, zufallsgeneriert oder von einer KI entworfen, das Risiko gibt es jetzt sowieso bei allem. Schlimm.
Ich gucke dann sicherheitshalber und etwas selbstquälerisch auch noch die Flaggen von Lettland und Litauen nach – die Lage wird dabei aber für meine Allgemeinbildung nicht besser. Ganz und gar nicht.
Zur Strafe sollte ich in diesem Leben noch ins Baltikum reisen, denke ich mir dann in angemessen sachlicher Schlussfolgerung. Zur gründlichen Vertiefung der mir offensichtlich so krass fehlenden Landeskunde. Man muss sich selbst bei so etwas manchmal hart rannehmen und manche Maßnahmen auch einfach mal durchziehen, wenn man Erfolge und Verbesserungen sehen will.
Dass ich damit dann erneut beim Thema Tourismus landen würde … Na gut, irgendwas ist immer.
***
Sie können hier Geld in die virtuelle Version des Hutes werfen, herzlichen Dank! Sollten Sie den konventionellen Weg bevorzugen und lieber klassisch etwas überweisen wollen, das geht auch. Die Daten dazu finden Sie hier. Wer mehr für Dinge ist, es gibt auch einen Wunschzettel.