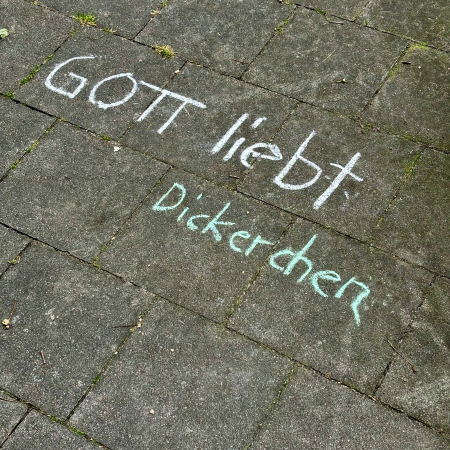Wie mittlerweile hinlänglich berichtet, ist unser Stadtteil touristisch überlaufen und reichlich mit Hotels, Reisegruppen und angeblich sehenswerten Szene-Locations versehen. Weswegen ich in der Hochsaison eine besondere Form der Spielplatzbesucherinnen beobachten kann, das sind die Reisenden in den Stunden zwischen Hotel und Bahnhof. Reisende, die zwei, drei seltsam leere, sicher etwas fad wirkende Stunden irgendwie herumbringen müssen. Weil sie das Hotel schon verlassen haben, vielleicht auch verlassen mussten, das nächste Verkehrsmittel aber noch nicht dran ist. Das fährt erst, und dann sieht jemand auf die Uhr … „Meine Güte, da haben wir ja noch Zeit!“
Eine Formulierung dieser Art ist vermutlich eine kollektiv bekannte Erfahrung, ebenso wie die daran anschließenden Überlegungen.
Ich kann aus vielen Erfahrungen, auch an anderen Orten, ableiten, dass etliche Menschen, vermutlich sogar die Mehrheit, mit dieser Zeit nichts anzufangen wissen. Man kauft vielleicht noch eben etwas ein, ein Getränk und Kekse für die Fahrt und dergleichen. Aber es ist danach immer noch so viel vom Nachmittag zu überbrücken.
Und da ist dann irgendetwas, das einen davon abhält, sich noch einmal oder wieder irgendwo hineinzusetzen. Um einen weiteren Kaffee zu trinken oder erneut etwas zu essen. Vermutlich hat man das gerade schon getan, ist bereits satt und getränkt, möchte nicht schon wieder Geld in den Touristenfallen ausgeben und hat darüber hinaus in dieser Gegend vermeintlich alles gesehen. Man möchte mit dem Gepäck außerdem nicht herumlaufen, man möchte eigentlich nur noch weg. Man möchte reisen, unterwegs sein. Selbst wenn es damit enden sollte, dass man dann wieder zuhause ist.
Man muss aber warten und warten.
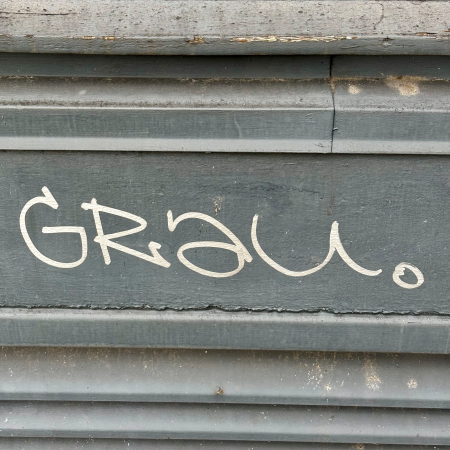
Dann suchen sich die Menschen in dieser Situation, was in Hamburg-Mitte gar nicht so oft zu finden ist, nämlich Sitzplätze im öffentlichen Raum. Sie gehen in Parks und in Fußgängerzonen, sie gucken in Nebenstraßen und Gänge, über die Zäune von Spielplätzen. Sie setzen sich auf alles, worauf man sich nur setzen kann. Nicht nur auf Bänke, die hier ohnehin eine Seltenheit sind.
Dann sitzen sie da herum. Eine Stunde, zwei Stunden. Sie sehen dabei höchstens mäßig gelaunt aus, deutlich abgeurlaubt, durchgereist und ferienvollendet. Sie sind geistig nicht mehr hier und noch nicht dort, sie sitzen gerade auf irgendetwas, aber auch zwischen Stühlen. Ihre Stimmung können sie vielleicht selbst nicht ganz einordnen und gucken leer, planlos und unmotiviert. Sie sehen aus wie: Die müssten mal abgeholt werden. Aber die holt dann keiner ab.
Ich nehme an, wir haben das alle schon so erlebt und auch bei anderen gesehen. Ich sehe es in diesen Sommerwochen dauernd.
Eine Gruppe möchte ich herausheben, weil sie in dieser besonderen Situation etwas kann, was alle anderen nun nicht mehr können. Etwas, das der Rest der Gesellschaft in den letzten beiden Jahrzehnten, man kann es tatsächlich eingrenzen, gründlich verlernt hat. So gründlich sogar haben es fast alle verlernt, dass sie das, was früher alle konnten und dauernd gemacht haben, nun in einem gewissen Kontext sogar mit einer neuen Vokabel bezeichnen und manchmal mit einem fast sportlichen Interesse versuchen, nämlich das Rawdogging. Ein Phänomen, bei dem sie es mit „Disziplin und Selbstkontrolle“ zu tun bekommen, so ihre Selbstwahrnehmung. Vielleicht ist es auch längst unser aller Selbstwahrnehmung.
Aber die Altersgruppe ab etwa Mitte 70 … Ich kann es vom Fenster aus wie ein Tierforscher beobachten, der mit der Kamera im Anschlag irgendwo im Unterholz auf seltene Vögel oder gut getarntes Wild lauert, die sitzt da einfach nur. Es hat nicht den Anschein von Selbstdisziplin und Kontrolle, nicht im Geringsten. Sie suchen sich geduldig einen Platz im Schatten, sie stellen die Koffer und Taschen so ab, dass sie alles jederzeit im Blick haben, denn man weiß ja nie.
Dann lehnen sie sich zurück und sehen über den Spielplatz und zu den schaukelnden Kindern. Sie sehen nach oben in das Laub der Bäume und mit etwas Glück auf die dort turnenden Eichhörnchen. Auf die Krähen blicken sie, auf die wartenden Tauben, Möwen und Elstern. Manchmal zeigen sie sich gegenseitig ein Tier. Sie wechseln dabei hin und wieder einen Satz, eher selten, bekommen aber nur kurze Antworten und reden sonst nicht viel. Den Menschen, den sie da neben sich haben, den haben sie in vielen Fällen auch schon jahrzehntelang neben sich. Da kann man auch einmal gemeinsam schweigen.
Sie legen die Köpfe in den Nacken, sehen am Kirchturm hoch bis zum Himmel und danach wieder auf ihre Füße, dann vor sich hin. Und sie machen es, man sieht es ihnen deutlich an, einfach so. Sie sehen dabei nicht auf ihre Smartphones, sie holen keine Notebooks heraus, sie tragen auch keine Kopfhörer, um Podcasts zu hören. Es sind Menschen von früher und sie verbringen diese zwei, drei öden, hohlen Stunden zwischen Hotel und Weiterreise, wie sie es immer schon gemacht haben, denn sie können das noch. Einfach so.
Man darf es sich aber nicht als Leistung vorstellen, es ist keine. Es ist nur das Leben und das Verhalten, das sie kennen. Und Menschen wie ich, die in den so analogen Siebzigern oder Achtzigern noch ganze Sonntagnachmittage mit glasigem Blick vor Raufaserwohnzimmerwänden verbracht haben, ab und zu leise stöhnend vor lauter Langeweile und bleierner Entschlusslosigkeit, wir können uns noch gut erinnern an das, was die da machen.
Wir kennen auch dieses kraftlose Körpergefühl des Wartens noch und auch die wattige Wahrnehmung des eigenen Hirns, in dem in diesen Stunden nicht allzu viel zu passieren scheint. Nur ein sachtes Verdämmern und Verblassen der Minuten.
Schön fanden wir das damals aber nicht, weiß Gott nicht. Das wissen wir noch sehr gut, dass es nicht schön war, und für eine Leistung haben wir es auch keineswegs gehalten, eher im Gegenteil. Selbst dann war es keine Leistung, wenn wir gut darin waren. Und es war uns recht, dass es irgendwann nicht mehr notwendig war und durch technische Hilfsmittel aus unserem Alltag verdrängt wurde. Wir haben also nicht zwingend einen Grund, diesen Teil unserer Vergangenheit auf einmal zu romantisieren und mit trendig klingenden neuen Namen wiederzubeleben.
Man kann es sich zwar auf eine gewisse Art als interessant und geistig herausfordernd denken, das ist schon verständlich. Aber man muss es nicht, und historisch, das scheint mir eindeutig, kommt es auch nicht hin.
Wenn meine Söhne dieses zweistündige, fast bewegungslose Verharren in einer optionslosen Warteschleife der unausgefüllten Art ohne jeden Input als Extremsport empfinden – okay, das passt für sie. Und ich bilde mir ein, beide verstehen zu können, die Seniorinnen und Senioren ab Mitte siebzig und die Teenager von heute. Ich bin mit beiden Varianten gut vertraut, ich bin ein alltagsgeschichtlicher Wanderer zwischen den Welten.
Neulich amüsierte ich mich an anderer Stelle über Silent-Reading-Partys, bei denen das romantisiert wird und als gemeinschaftliches Reenactment zelebriert wird, was für uns damals ebenfalls vollkommen normal war: Das stille Lesen. Sogar mit mehreren in einem Raum. Das ist heute ein Event, und ich lache immer noch darüber. Allerdings lache ich freundlich und fast schon altersmilde, nicht zynisch und herablassend.
Das Überraschende für mich ist dabei, dass ein beliebiges Stück Alltag also nur rund 50 Jahre braucht, um in verklärter, neu interpretierter Form wiederauferstehen zu können. Weswegen ich jetzt auch hochrechnen und vorhersagen kann, dass es etwa im Jahr 2075 eine ziemlich coole Sache und ein heißer Trend werden dürfte, ganze Sonntagnachmittage mit dem unentwegten Gucken von algorithmisch zugeteilten Tiktok- und Instagram-Filmchen in höchst obskurer Mischung zu verbringen. Gechillte Plattform-Partys wird es dann geben.
Ich werde sicher nicht mehr alt genug, um es erleben zu können. Ich würde sonst darauf wetten wollen, denn so wird es kommen.
***
Sie können hier Geld in die virtuelle Version des Hutes werfen, herzlichen Dank! Sollten Sie den konventionellen Weg bevorzugen und lieber klassisch etwas überweisen wollen, das geht auch. Die Daten dazu finden Sie hier. Wer mehr für Dinge ist, es gibt auch einen Wunschzettel.