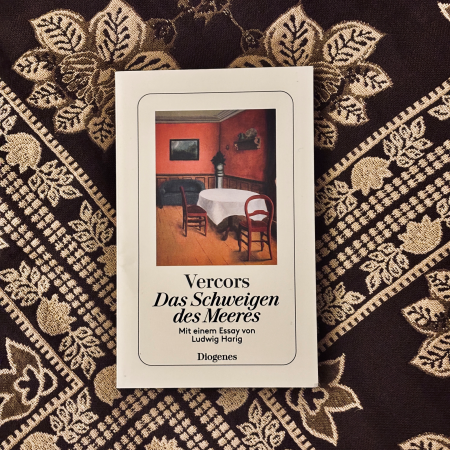Noch einmal kurz zum neulich bereits erwähnten Viktor Frankl. Es bleibt für mich doch interessant, diesen intensiv denkenden Menschen wie Fromm oder Frankl auf YouTube etwas hinterherzugehen.
***
Und wo ich schon bei „YouTube als moralische Anstalt betrachtet“ bin: Walther Ziegler hat mich dort erneut und hoffentlich erfolgreich belehrt. Diesmal mit einer unterhaltsamen Stunde über Jean-Paul Sartre.
Auch von Walther Ziegler habe ich noch einige Vorträge übrig, was mir sehr angenehm ist.
***
In Hamburg findet dieser Tage der venezianische Karneval statt. Eine kleine, sehr feine und, man hört es staunend, nicht kommzerzielle Veranstaltung. Von Liebhaberinnen und Liebhabern der Sache getragen. Einfach so.





***
Passend für den Freundeskreis Philosophie und Overthinking, auch noch passend für die Anhängerschaft Frankls und der Logotherapie, hörte ich einen Podcast über den Sinn des Lebens. Man will sich auch nicht immer nur mit den kleinen Themen des Alltags beschäftigen, nicht wahr. Ab und zu auch mal im größeren Bogen denken: „Anderen wichtig sein“, bei Detektor.fm. 22 Minuten, mit Denkbeispielen und allem.
***
Vanessa schreibt über die Jugend von heute, die Kaltmamsell ergänzt.
Wozu ich nur kurz etwas ergänzen möchte. Ein Aspekt, der hier vor Jahren schon einmal vorkam und der eher unterschätzt wird, so weit ich es mitbekomme. Ich kann nur für die paar jungen Menschen Aussagen treffen, die ich kenne, etwa weil ich sie selbst gezeugt und großgezogen habe, es mag also nicht für alle Gültigkeit haben. Aber da diese jungen Menschen schon im Kindergarten und in der Grundschule usw. Methoden der Konfliktklärung und der Mediation wie nebenbei erlernt haben, weil es für sie in all diesen Einrichtungen immer normal war, über Konflikte zu reden und Interessen und Gefühlslagen abzuwägen, haben sie eine vollkommen andere Art (oder zumindest das Potential dazu), mit Problemen umzugehen.
Und zwar ist diese Fähigkeit bei ihnen teils dermaßen ausgeprägt und wird mit einer Selbstverständlichkeit angewandt, dass gewisse Vorgängergenerationen, etwa meine, dagegen etwas steinzeitlich anmuten. Wir haben auf dem Schulhof noch Keulen geschwungen.
Mit anderen Worten: Über Stuhl- und Morgenkreise etc. kann man gut spotten, aber völlig sinnlos kommen sie mir nach ein paar Jahren der Beobachtung nicht vor.
***
Kid37 hat eine neue Waschmaschine und eine langjährige Beziehung beendet.
***
Bei arte sah ich die zweiteilige Doku über Walt Disney und schloss auch dabei einige Bildungslücken: „Der Zauberer“. Sympathischer wird der Meister einem nicht zwingend, wenn man etwa an seinen Umgang mit den Gewerkschaften, an seinen Despotismus etc. denkt. Aber ich habe auch nicht genau gewusst, wie groß sein persönlicher Anteil an vielen Erfolgen der Disney-Firma war. Es ist dann doch beeindruckend.
***
Diese Serien-Rezension zu „The Danish Woman“ klingt so, als würde ich das sehen wollen.
***
Apropos Film und Serie: Markus wies auf Bluesky auf die Seite „Wikiflix“ hin, welche hier erläutert wird und hier zu finden ist und einen schon auf den ersten Blick lange, lange mit Filmmaterial versorgen kann, noch über die Saison der diesjährigen Winterabende hinaus.
Auch z. B. mit frühen Disney-Klassikern wie Steamboat-Willie, wo ich doch gerade dabei war.
***
Ebenfalls auf arte sah ich die Sendung über Hannah Arendt: Eine Jüdin im Pariser Exil. Einige der alten Interview-Aufnahmen mit ihr sind darin und ich habe wieder bemerkt: Ich höre sie sehr gerne reden, ich finde sie äußerst gewinnend.
***
Auf Bücher von Menschen, die ich kenne, weise ich besonders gerne hin. In dieser Rubrik wird es bald ein neues Werk von Meike Winnemuth geben. Genauer im März, also gleich schon, mit etwas Optimismus betrachtet. Ich kenne es noch nicht, aber thematisch wird es ganz zweifellos zu mir passen: „Eine Seite noch – Warum Lesen uns so glücklich macht“ (Verlagslink).
***
Sie können hier Geld in die virtuelle Version des Hutes werfen, herzlichen Dank! Sollten Sie den konventionellen Weg bevorzugen und lieber klassisch etwas überweisen wollen, das geht auch. Die Daten dazu finden Sie hier. Wer mehr für Dinge ist, es gibt auch einen Wunschzettel.