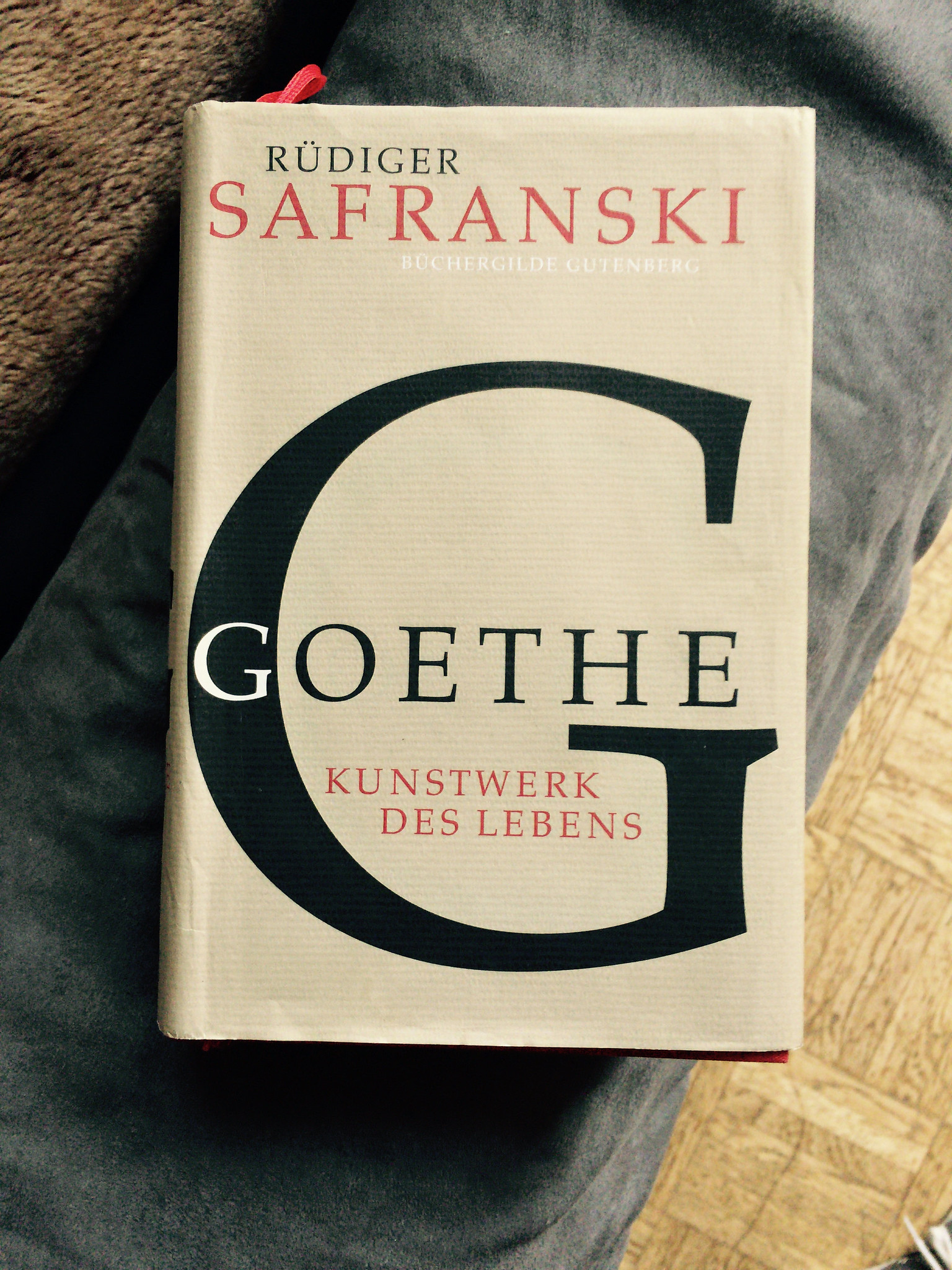Die nächsten Wochen bieten sich für Geschenktipps an, nicht wahr, einige ratlose Menschen werden schon auf der Suche sein. Die Söhne und ich geben also ab und zu ein paar Hinweise auf Sachen, die uns in diesem Jahr gefallen haben – ohne Affiliate-Gerödel, ohne bezahlte Werbung, einfach so.
Los geht es mit zwei vermutlich seltsam anmutenden Hinweisen. Nach den Spielerfahrungen hier zu urteilen, die ich nicht nur bei den Söhnen sondern auch bei deren Freunden beobachtet habe, handelt es sich aber in beiden Fällen um so etwas wie völlig unterschätze Knaller. Nämlich erstens: Ein Geldzählbrett. Wenn unklar, bitte den Begriff genauso googeln, dann staunen und erinnern, das hat man doch mal bei der Bank oder der Post gesehen. Das soll ein Spielzeug sein? Was?
Und ob es eines ist. Es ist erheblich interessanter als jedes Sparschwein, es führt zu stundenlanger und hochkonzentrierter Geldzählerei, es übt ganz nebenbei auch noch Mathe mit den Kindern. Und nachdem ich das jetzt wochenlang beobachtet habe, möchte ich mit großer Sicherheit behaupten – das Ding macht Kindern Spaß. Man kann es natürlich auch sehr passend mit einem Sack Kleingeld überreichen, das macht das Geschenk sicher noch attraktiver, sehr kleines Kleingeld reicht auch.
Hier gab es das zur Einschulung von Sohn II, und die Söhne haben spontan beschlossen, künftig gemeinsam zu sparen und das Geld nur noch in dem Teil aufzureihen und zu zählen. Das hatte dann noch einen Nebeneffekt, denn weil die Söhne selbstverständlich zwischendurch doch einmal Einzelwünsche haben, müssen sie eventuell entnommene Anteile von der Gesamtsumme abziehen, die dann wieder neu durch zwei geteilt werden muss, um die Anteile neu zu justieren und wieder und wieder abzuwägen, ob nun gemeinsame oder Einzelziele attraktiver sind. Das ist gar nicht unkompliziert, denn man muss sich für derartige geschäftliche Entscheidungen mehrere Zahlenwerte merken – aber man staunt, wie die Kinder plötzlich rechnen können, dabei entstehen sogar erstmals im Leben formelartige Notierungen. Es ist eben alles eine Frage der Motivation.
Der zweite Tipp ist eigentlich so naheliegend, dass ich mich fast wundere, wieso man das Gerät nicht längst in jedem Kinderzimmer findet: eine mechanische Schreibmaschine. Die bekommt man auf dem Flohmarkt für kleines Geld, Farbbänder und Tippex gibt es immer noch im Handel, das Zeug riecht sogar noch wie früher, da staunt man. Eine mechanische Schreibmaschine ist für alle Kinder ab Vorschule ein Hauptspaß, ein Sofortdrucker ohne Bildschirm, ein krasses Gadget mit Retromechanik – und man kann damit sogar richtige Botschaften produzieren! Die andere gleich lesen können! Ohne App oder Programm oder besondere Hardware oder so, ganz einfach, das freut auch den Feind des Digitalen, es gibt doch in allen Familien solche seltsamen Vögel. So eine Schreibmaschine ist erstens wirklich bestes Entertainment für die Kinder, sie ist zweitens mittlerweile aber auch ein veritables Stück Kulturgeschichte und übt dann noch Buchstaben und sowieso irgendwann erwünschte Tastaturkenntnisse – und sie sorgt für eine Geräuschkulisse im Kinderzimmer, bei der zumindest Menschen meines Alters schwerst nostalgisch werden und plötzlich bei der Arbeit wieder rauchen möchten, wie damals, als man noch im Einzelbüro saß und tagelang zweifingrig auf die Buchstaben hämmerte, man kann es sich schon fast nicht mehr vorstellen.
Aber da reißt man sich als Vorbild natürlich zusammen und raucht nicht. Und man braucht auch kein Nikotin, man kann ja ab und zu ja am Tippex schnüffeln. Wenn die Kinder nicht hingucken, versteht sich.
Geldzählbrett und mechanische Schreibmaschine jedenfalls – beides Zeug aus der Vergangenheit, beides sicher überaschende Geschenke. Es muss nicht immer alles erwartbar sein.