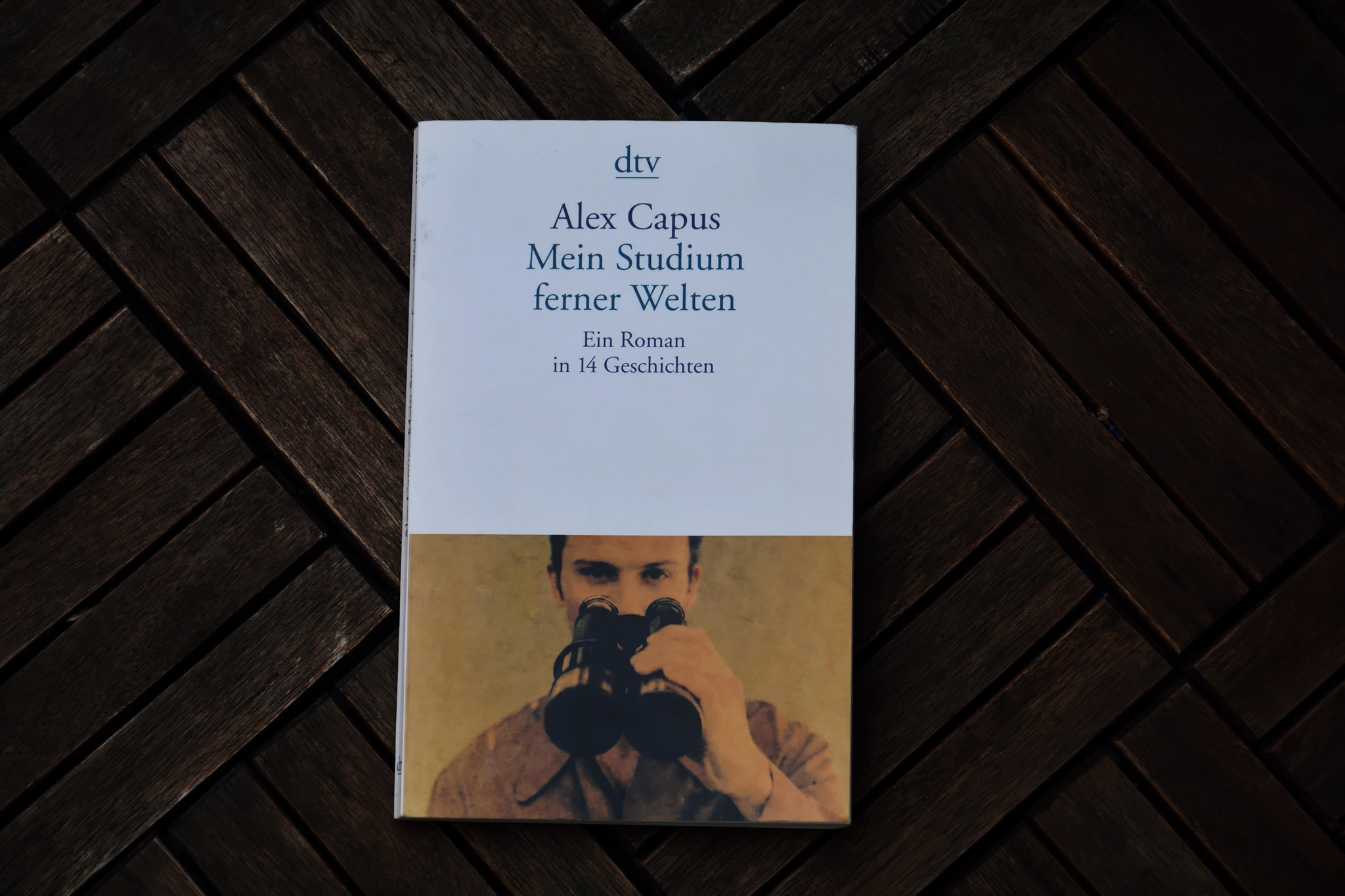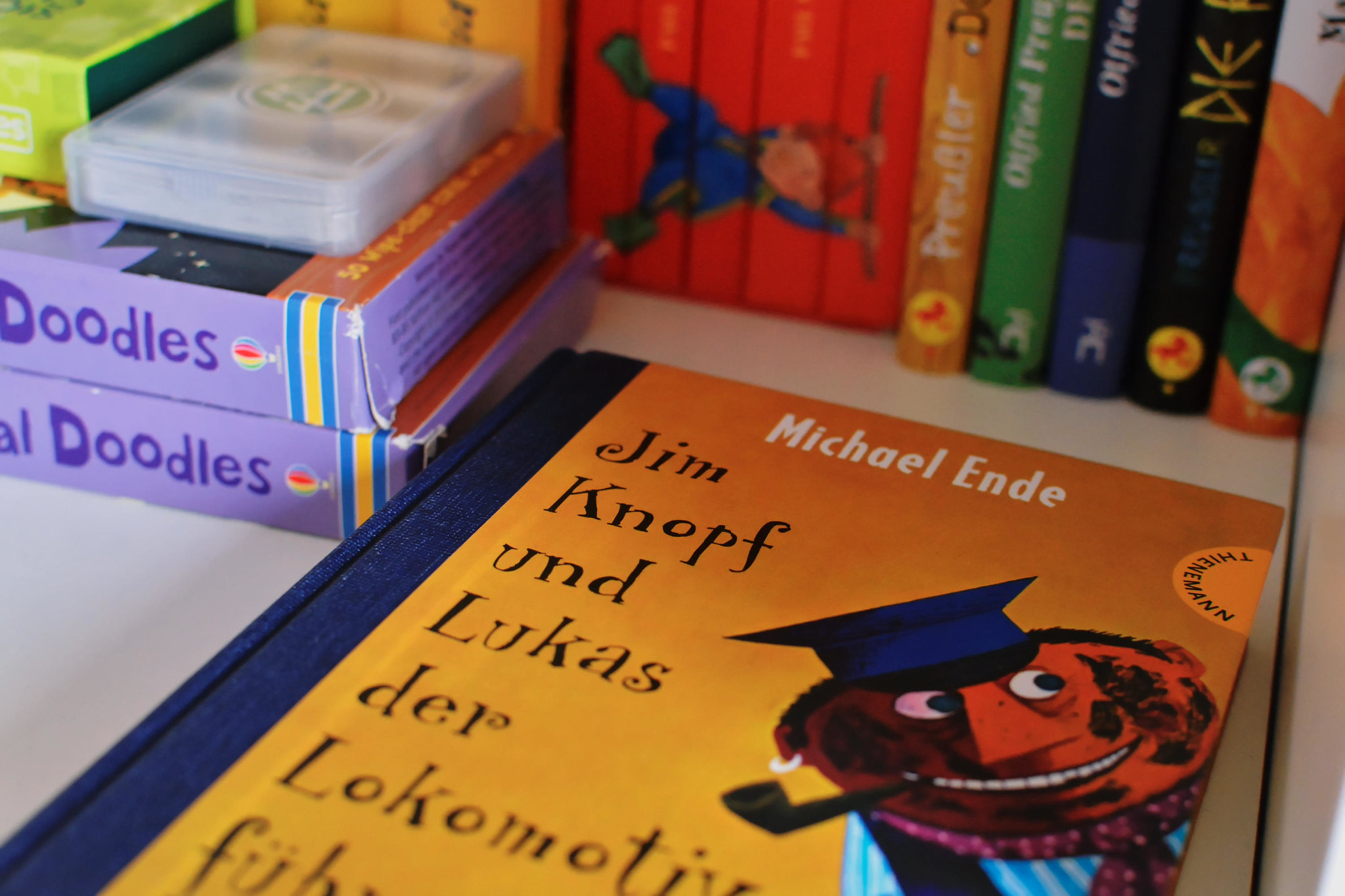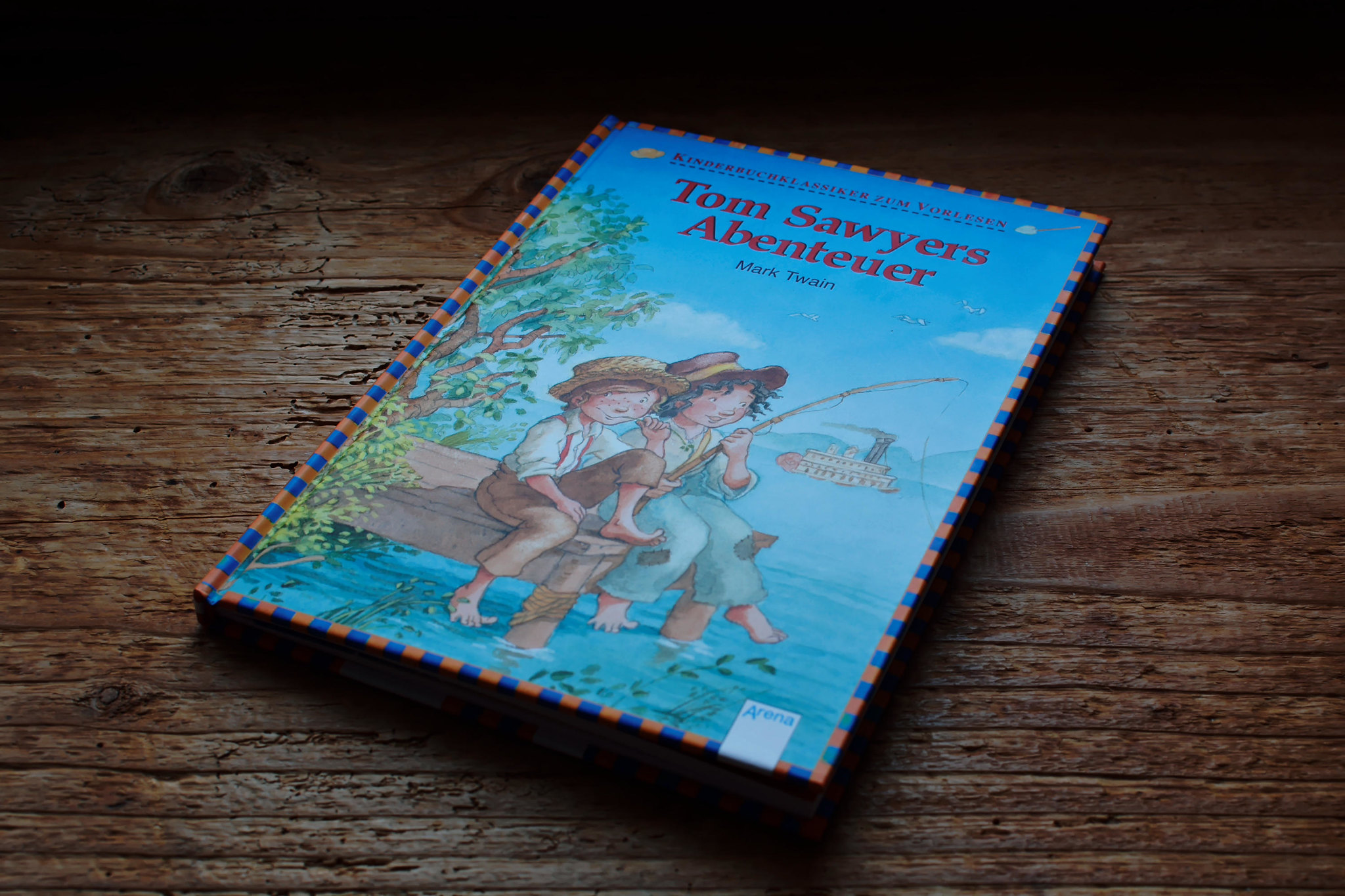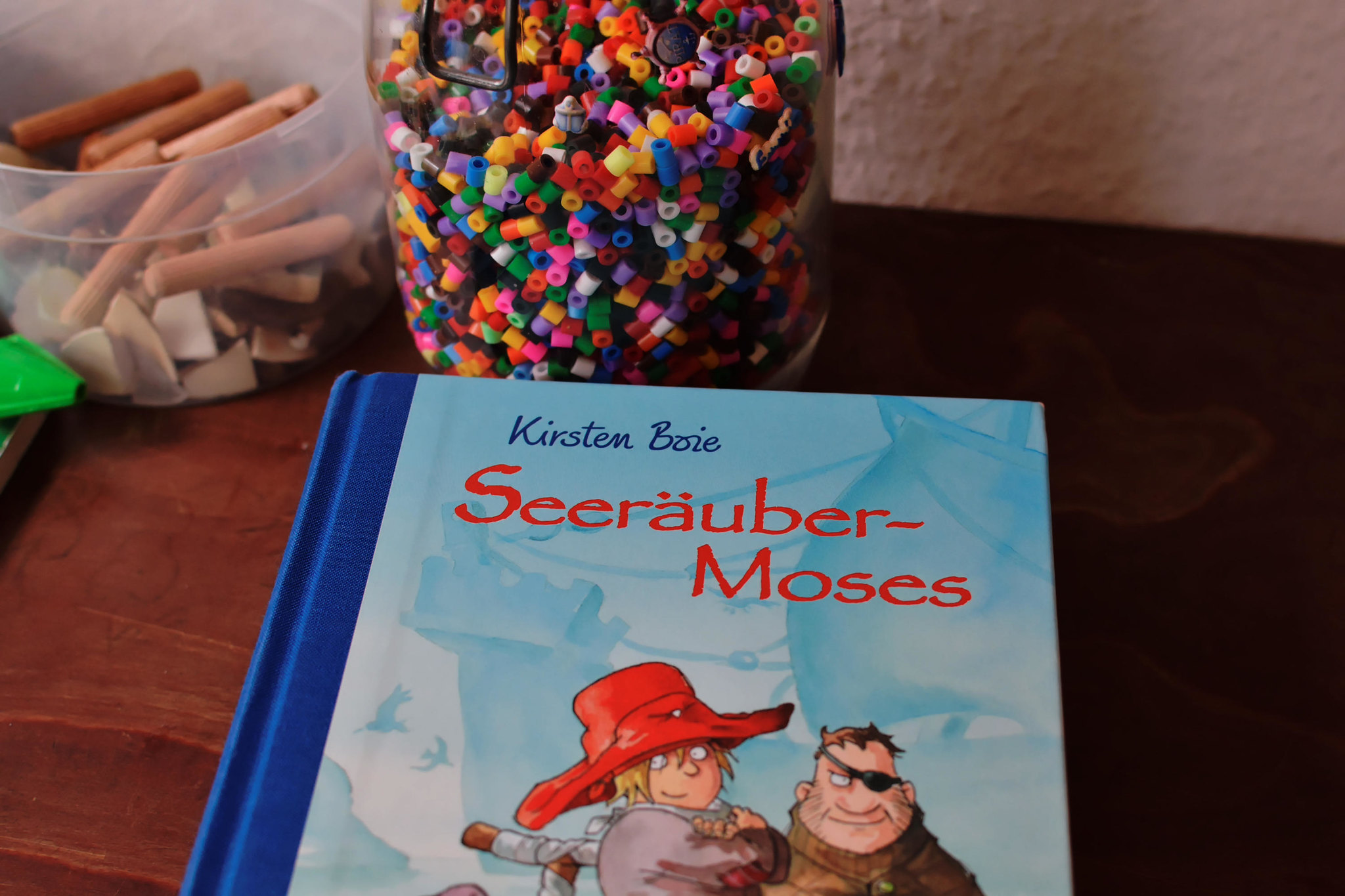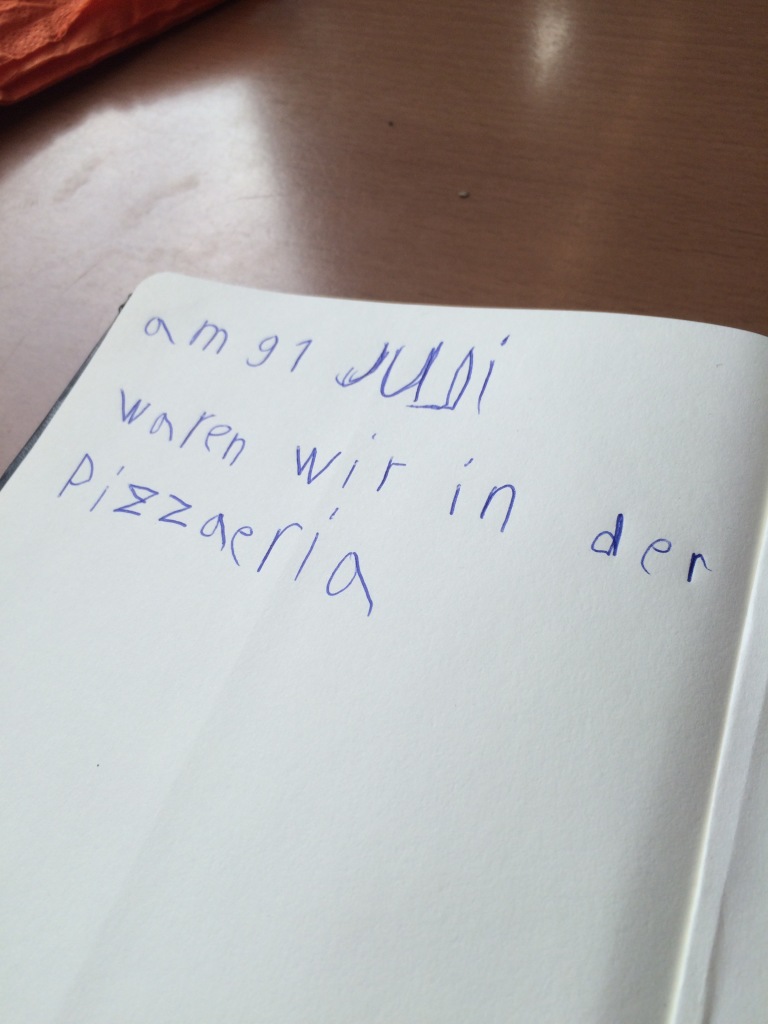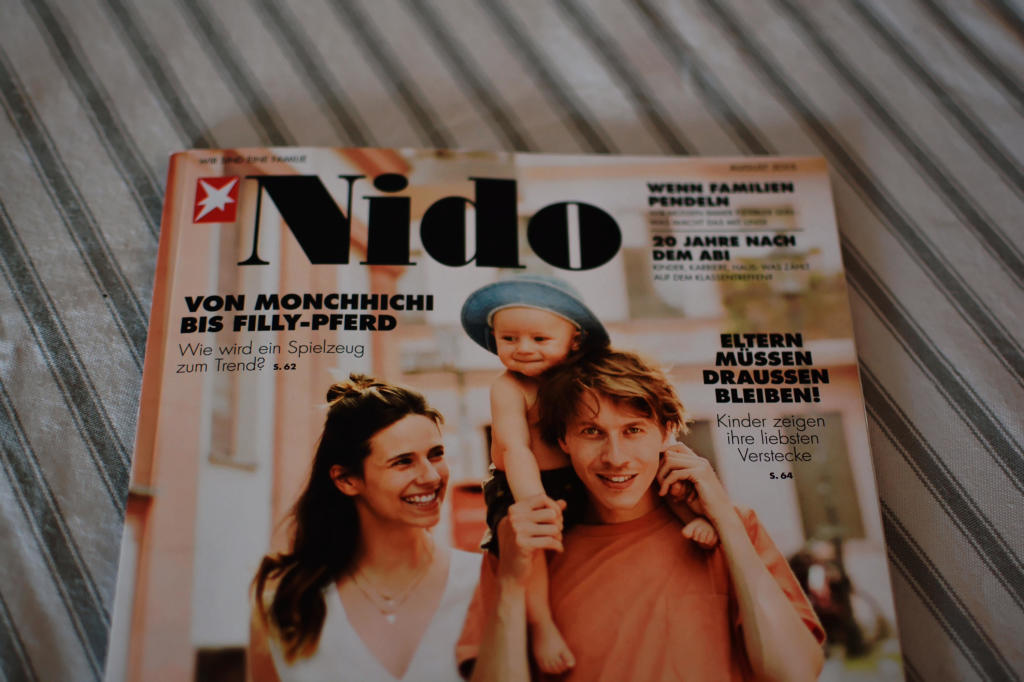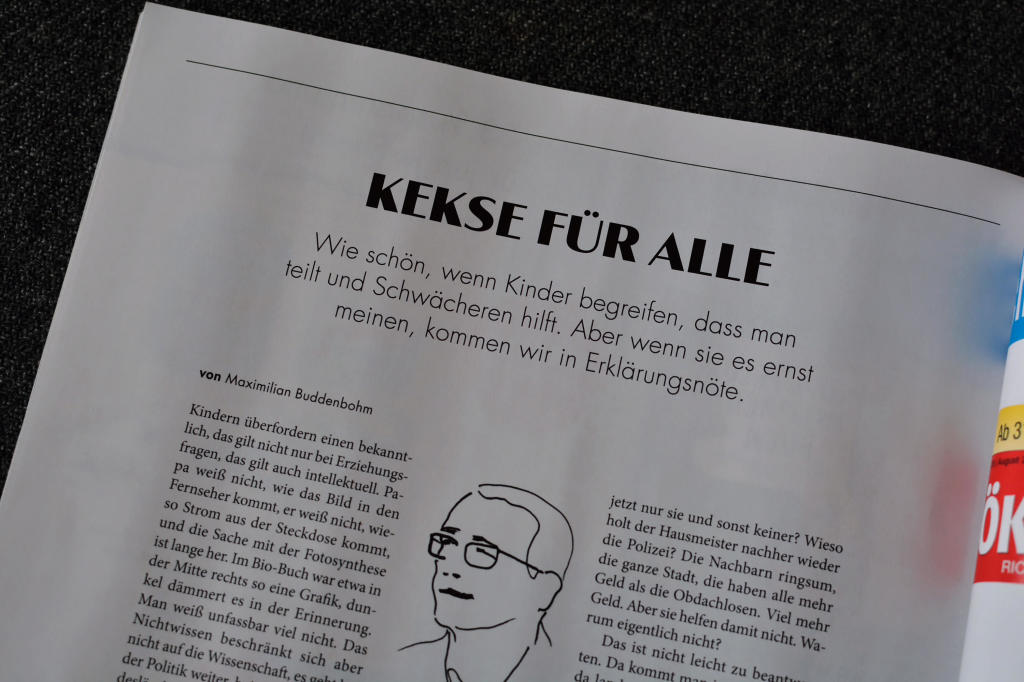Die Urlaubsberichte hier haben sich etwas verzögert, da wir zwischendurch auf Eiderstedt waren. Auf der Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland gibt es so viel Netz wie auf dem Mond, vielleicht auch etwas weniger, es würde mich überhaupt nicht wundern. Weswegen der Urlaub hier im Blog immer noch mit Ladehemmung beim zweiten Tag Südtirol hängt und ich jetzt eine kleine Aufholjagd starte, um irgendwann auch wieder in der Gegenwart anzukommen.
Wobei nach Südtirol aber natürlich noch Eiderstedt gewürdigt werden muss, wie auch überhaupt besprochen werden muss, was so gegensätzliche Reisen direkt nacheinander nun bedeuten. Sind wir jetzt auf Normalnull? Oder völlig verwirrt? Es ist, das kann ich vorwegnehmen, kompliziert.
Das Schloss Lebenberg also, um wieder im Süden fortzusetzen, das uns bei der Anreise in Tscherms so transsilvanisch anmutend im Abendlicht entgegenleuchtete, es sah im Vormittagssonnenschein gar nicht mehr sehr beeindruckend aus. Etwas kleiner als gedacht. Etwas weniger spektakulär. Und gar nicht unheimlich. Das war ein Schloss, von dem man, wenn man direkt davor stand, gar nicht mehr so viel erkennen konnte. Mauern eben, gar nicht mal so hoch, nicht einmal aus Kindersicht. Ein weiter Blick ins Tal von den Zinnen des kleinen Vorhofs, der Blick war wirklich gut. Aber guten Blick hatte man da am Berg von überall, dafür brauchte man eigentlich gar kein Schloss. Eine kleine Tür, ganz unscheinbar, da stand etwas dran. “Nächste Führung um 11:45”, das konnte Sohn I uns vorlesen. Mit der Hand geschrieben, Kreide auf Tafel, saubere Handschrift. Ein leerer und schmuckloser Vorraum, da warteten noch zwei Touristen. Sitzen und warten also, immerhin nur zehn Minuten, da hatten wir Glück.
Dann ging die Tür zum Inneren des Schlosses endlich auf, langsam ging sie auf, und natürlich, sie knarrte ein wenig, das konnte auch gar nicht anders sein. Ein alter Mann kam heraus, er ging ganz langsam, er hatte alle Zeit der Welt. Aus Sicht der Söhne war er uralt, versteht sich. Er sah uns an, er sah die anderen beiden Wartenden an, er wirkte ein wenig, als würde er überlegen, ob sich eine Führung für uns denn auch lohnen würde. Sahen wir überhaupt interessiert genug aus? Er guckte eine Weile von Besucher zu Besucher und nickte schließlich. Dann beugte er sich zu den Söhnen, sah sie auch lange an, beugte sich dann ein wenig zu ihnen hinunter und fragte endlich höflich und mit leiser Stimme, in einem etwas leierndem Tonfall, den man wohl unweigerlich annimmt, wenn man schon Tausende von Menschen durch ein Schloss geführt hat und immer wieder gleichförmige Sätze von sich gibt, jeden Tag, immer noch einmal: “Was wünschen die jungen Ritter? Was ist Euer Begehr?”
Und damit hatte er sie. Von diesem Moment an hörten sie ihm gebannt zu, ganz egal, ob er während der Tour durch das Schloss von längst ausgestorbenen Adelsgeschlechtern sprach, von der Renaissance, von Schlossgeistern, Hieb- und Stichwaffen, gotischen Schränken, dem Rokoko oder mitttelalterlichen Fresken. Immer wieder wandte er sich während der Führung an die Jungs, sprach sie direkt an, ohne seine Erwachseneninhalte dabei abzuwandeln, aber er nannte doch immer wieder ihre Namen, die er freundlich erfragt hatte, er wies sie immer wieder leise und nebenbei darauf hin, womit sie später in der Kita und in der Schule vielleicht angeben könnten. Die Söhne waren hingerissen und fühlten sich sehr ernstgenommen. Man durfte im Schloss natürlich nichts anfassen und auf nichts herumturnen, es war zur Abwechslung einmal überhaupt kein Problem. Sie liefen lammfromm dem alten Mann hinterher, der so viel über das Gemäuer zu berichten wusste. Und das sind so die Überraschungen im Urlaub, Man denkt vielleicht, ach, Besichtigung nur mit Führung, wie langweilig ist das denn? Innen auch noch Fotoverbot? Muss das denn? Und dann ist es eine großartige Stunde, die man hinterher nicht missen möchte. Und von der die Söhne noch wochenlang reden werden.
Das Schloss Lebenberg ist in Reiseführern gar nicht so prominent, ich möchte dennoch dazu raten, es zu besuchen. Es ist ein immer noch bewohntes Schloss, aber der Teil, den man mit Führung besichtigen kann, ist rappelvoll mit Kunst und schon hinter der ersten Tür steht man vor ganz unvermuteter Pracht. Man fühlt sich dem gegenüber ohne Anke Gröner etwas hilflos, aber da muss man durch. Kunst aus etlichen Jahrhunderten, das Schloss ist alt. Und ohne dass ich es erklären könnte, man hat ja schon etliches an Kunst im Leben gesehen – das waren Stücke, die mich ansprachen. Das war eine Gesamtauswahl, die mir Geschichten erzählen wollte, das waren redende Dinge. Manchmal sagt einem ein ganzes Museum nichts, manchmal spricht eine kleine Sammlung Bände. 
Bei den Beschreibungen muss ich ohne Bilder auskommen, Fotos konnte man nur im Innenhof machen. In der kleinen Kapelle hängt in einem Fenster ein Bild des aufgebahrten Jesus. Es hängt seit Jahrhunderten vor einem Nordfenster, es wurde nie restauriert. Der Jesus leuchtet aber bis heute golden, einfach durch das Tageslicht, das durch ihn fällt, und er leuchtet so golden, als wäre es eine höchst effektvolle und sehr moderne Lichtinstallation. Er strahlt aus sich, man möchte wetten, dass dahinter etwas leuchtet, etwas ganz Starkes sogar – aber da ist nichts, nur der taghelle Norden. Auf die Gläubigen früherer Generationen muss das Bild mächtig Eindruck gemacht haben.
Ein gotischer Schrank steht da in einem Saal, gotische Schränke sieht man selten, man hat eher die Truhen aufbewahrt. Gotische Truhen kennt vermutlich jeder, gotische Schränke nicht unbedingt. Und, es kommt einem etwas irre vor, der Schrank sieht so absurd modern aus, den könnte man auch im Stilwerk in Hamburg bestellen, der ist allerneuestes Design. Etwas roh, etwas unbehauen, etwas schräg, urwüchsiges Holz mit deutlicher Maserung. So etwas sieht man in Modern-Living-Magazinen, das nimmt man bei der Homestory eines Architekten nebenbei wahr, das steht da im Arbeitszimmerhintergrund oder auf irgendeinem Instagrambild aus einem Coffeeshop in New York. Wir standen eine ganze Weile kopfschüttelnd vor dem Schrank, der Schrank war unglaublich.
Daneben ein Klappbett. Man muss nicht glauben, Klappbetten seien eine Erfindung von Ikea, Klappbetten sind uralt. Und das Prinzip ist immer gleichgeblieben, nur die Nupsis verändern sich vermutlich stetig und passen dann nicht mehr. Das war damals schon schlimm, es ist heute noch genau so schlimm.
Ein Reisebett aus dem Mittelalter, und man sieht den designgeschichtlichen Weg zur faltbaren Campingliege deutlich vor sich, wie in einem Bilderbuch der Möbelgeschichte. Man sieht aber auch die Knechte, die das Trumm damals tragen mussten. Und den Familienvater, der heute fluchend das Campingzubehör im Kombi verstaut.
Beim Verlassen eines Saals drückte der Schlossführer die Klinke der Tür betont langsam, dann drückte er sie noch einmal und noch einmal, bis alle es gesehen hatten – das Schloss der Tür war feinste Schmiedekunst, uralt. “Nie repariert”, sagte der Schlossführer, während seine Hand die Klinke streichelte, “geht wie am ersten Tag. Geht auch in hundert Jahren noch.” Und er sagte es so, als sei er all die Jahrhunderte dabei gewesen, als hätte er die Tür jeden Tag mehrfach geöffnet und geschlossen. Und als würde er das noch sehr lange machen wollen. Vermutlich verachtet er alle Schließmechanismen jüngeren Datums und geht überhaupt nur widerwillig durch moderne Türen.

Im Garten draußen ein ungeheuerlicher Maulbeerbaum, warum ist der so groß? Man weiß es nicht, da rätseln auch Experten, es muss am Mikroklima liegen, niemand kann es erklären. Maulbeerbäume werden nicht so groß. Der Maulbeerbaum war für Seidenraupen da, man wollte damit einmal in der Gegend das große Geld machen. Etwas später kamen die Südtiroler aber darauf, mit anderen Bäumen das große Geld zu machen, das hat dann viel besser funktioniert und die Apfelbäume stehen bis heute überall. Der Innenhof sieht so gut erhalten mittelalterlich aus, der ist oft als Filmkulisse zu sehen. Weihnachten gibt es im Ersten wieder einen Märchenfilm, der gerade dort abgedreht wurde. Ich habe vergessen, welches Märchen es war.
Wieder drinnen ein seltsam frisch wirkender Rokokosaal mit lachsrosafarbener Tapetentür, wie gerade eben erst von behandschuhter Damenhand leise geschlossen, während hinten noch das Cembalo verklang. Passt Cembalo überhaupt zu Rokoko? Was weiß ich denn. Mit Kunstgeschichte habe ich mich schon lange nicht mehr befasst, es ist eigentlich bedauerlich.
Es ist andererseits aber auch völlig egal, ich wollte nur sagen, das Schloss lohnt sich, auch wenn es in manchen Reiseführern nur gerade für eine Randbemerkung reicht. Ein kleines, prächtiges Schloss. Nur mit Führung. Und Fotografieverbot innen.
Macht nichts.