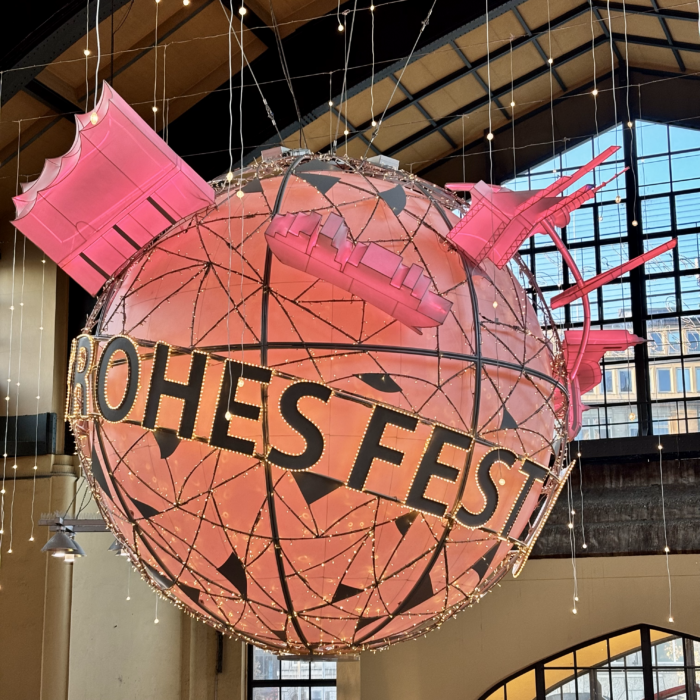Es regnet, es ist dunkel, es ist kalt. Alles ist außerdem etwas anstrengend, die Müdigkeit stapelt sich immer weiter auf. Eine etwas ungünstige Gemengelage, und da hat man die Nachrichten noch gar nicht gelesen, die allein schon reichen würden, um die Stimmung gründlich und für Wochen derart zu ruinieren, dass die Bettdecke überm Kopf auch nicht mehr zuverlässig helfen kann.
Am Nachmittag ein Termin bei der Zahnärztin, und das ist dann das einzig Nette am Donnerstag, denn da muss ich nur liegen und den Mund aufmachen. Es sind überschaubare Anforderungen, und es ist mir recht so, kurz raus aus der Überforderung. So also fällt es jetzt aus.
Dennoch schreitet währenddessen alles weiter voran, immerhin haben wir heute schon Nikolaus erreicht, ein weiterer Milestone in der Schedule unserer Challenges, wie wir im Büro sagen würden. Wobei Nikolaus in einem Haushalt mit Teenagern eine nur noch lapidare und routinierte Abwicklung verlangt.
In meinem Adventskalender gibt es Marzipan zum Frühstück, ich esse es am Freitagmorgen nebenbei, während ich das Nikolauszeug aus dem Schrank hervorkrame und anhand der Schuhvielfalt vor der Tür festzustellen versuche, wie viele Teenager eigentlich in dieser Wohnung sind. Mindestens vier werden es sein, schließe ich dann. Es macht nichts, wir haben für alle Fälle vorgesorgt, die Herzdame und ich, wir sind dermaßen vorausschauend und gut organisiert. Also zumindest manchmal.
An der Zuordnung, welche Schuhe zum wem gehören könnten, scheitere ich dann aber doch. Es sind jedenfalls viele Schuhe größer als meine.
Selbstverständlich ist das Marzipan im Adventskalender aus meiner Heimatstadt, denke ich beim Kauen. Irgendwo bleibt einem immer noch ein Bezug zur Herkunft. Das Saisonale, das Gewohnte, das Süße.
Neulich sah ich im Vorbeigehen wieder große Steckrüben im Gemüseregal des Supermarktes, fällt mir dabei ein. Damit könnte ich auch noch einmal etwas Lokalpatriotisches anstellen, mit Bezug zur Region und auch zur Familiengeschichte. Einen winterlichen Eintopf wie damals könnte ich machen, wie von Oma, wie in Lübeck. Wie damals, wie in den Siebzigern. Die, ob sie dafür nun eine gute Wahl waren oder nicht, meine Essgewohnheiten nachhaltig geprägt haben.
Erst einmal Steckrüben googeln, immer alles nachlesen. Der erste Treffer ist gleich ein Rezept mit dem entscheidenden Hinweis: „Wie von Oma“, denn wir suchen bekanntlich alle Ähnliches. In mancher Beziehung wird es wohl ein Rückweg sein, den wir da suchen, und sei es nur in der Küche. Das gehört auch so, nehme ich an.
Habe ich noch ein Lübeckbild irgendwo? Ja, eines noch. Da um die Ecke habe ich einmal gewohnt.

Den Begriff „Lübecker National“ für diesen Steckrübeneintopf habe ich erst als Erwachsener kennengelernt. Das Gericht war bei uns so werktäglich unspektakulär, es hatte nicht einmal einen Namen. Ich habe auch spät erst verstanden, dass es sich um ein ausdrücklich norddeutsches Essen handelt. Etwa ab Südwestfalen ist es schon eher unüblich, glaube ich, weiter runter ist es dann gar nicht mehr bekannt.
Schon beim Gedanken an den Erwerb der verlockend aussehenden Rübe dann allerdings wieder der antizipierende Unmut, dass der Mensch an der Kasse im Supermarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 50% nicht wissen wird, was das denn bloß sein könnte, dieses Teil. Das Ding wird ratlos in der Hand gedreht werden, ich weiß es ja schon, und dann wird die Frage wieder kommen, fast unweigerlich und alle Jahre: „Ist das Knollensellerie, was ist das? Kohlrabi? Hä?“ Ich kann es schon hören.
Die Frage geht an an mich, zur Sicherheit aber auch an die Kolleginnen, denn ich könnte doch Unsinn erzählen. Dann das Blättern in den zerknitterten Papieren mit den aktuellen Sonderpreisen neben der Kasse, der Zeigefinger wird die Spalten entlangfahren. Wie gibt man das denn jetzt wieder ein? Kopfschütteln, Suchen, dann endlich: „Ach so!“
Je-des-mal ist das so. Man ist längst ein Exot, wenn man so etwas kauft, das Gemüse von damals. Was recht bedacht eine eher abgefahrene Ironie der Geschichte ist. Unsere Oma, unsere kollektive norddeutsche Oma sozusagen, sie würde eine Weile brauchen, lebte sie denn noch, um sich diese Entwicklung in der Alltagskultur vorstellen zu können.
Nie habe ich diesen Eintopf in meiner Küche perfekt hinbekommen, bei allen Versuchen nicht. Nie war er voll befriedigend oder auch nur ausreichend erinnerungsgerecht. Immer blieb etwas fremd, immer fehlte irgendetwas. Vermutlich fehlt aber am Ende entscheidend und dauerhaft vor allem die Nichtzuständigkeit für das Gelingen des Essens.
Egal. Ich bekomme es so hin, dass es völlig okay ist. Das gilt längst nicht für alles im Leben und schon gar nicht in diesem Jahr, daher werde ich es mir beim Kochen und Probieren auch aufsagen müssen, dass es völlig okay ist.
Es hilft manchmal kurz, sich so etwas mitzuteilen.
***
Sie können hier Geld in die virtuelle Version des Hutes werfen, herzlichen Dank! Sollten Sie den konventionellen Weg bevorzugen und lieber klassisch etwas überweisen wollen, das geht auch, die Daten dazu finden Sie hier. Wer mehr für Dinge ist, es gibt auch einen Wunschzettel.