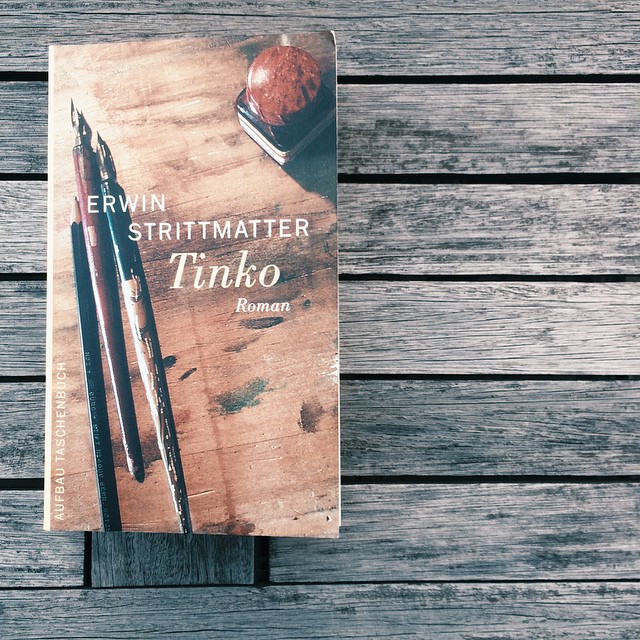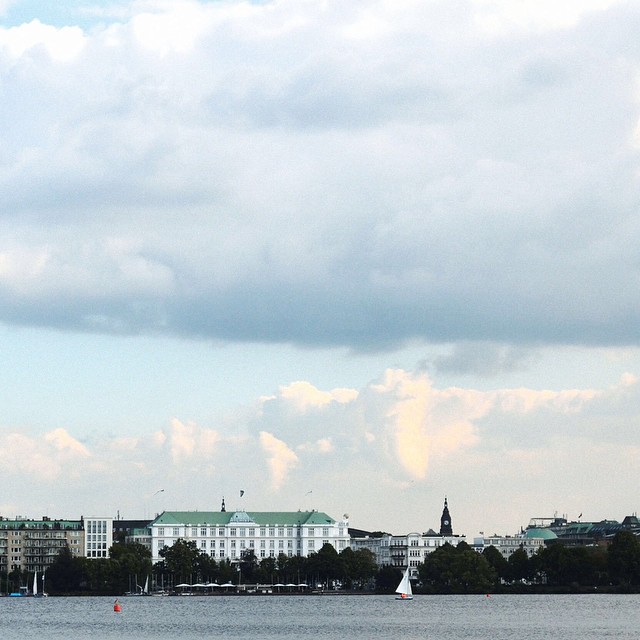Die anderen Erstklässlereltern lerne ich am intensivsten kennen, wenn sie mich vor der Schule über den Haufen fahren.
— Magnus MacNiemann (@grindcrank) 1. September 2014
Wir haben das Gequengel der Kinder während der Fahrt in den Urlaub aufgenommen und werden das als Verhütungs-CDs verkaufen.
— ypsn (@Gehirnkram) 1. September 2014
Spätzle schaben und Kinderköpfe streicheln ist in Schwaben übrigens die gleiche Handbewegung.
— Pamela Brühschwein (@zirkuspony) 30. August 2014
– Guten Tag, ich hätte gerne Kniestrümpfe Größe 33 – Für Jungen oder Mädchen? – Für Füße bitte
— Patricia Cammarata (@dasnuf) 3. September 2014
Das Kinderkeyboard wird weder verschenkt noch verkauft, wenn es ausgedient hat. Es wird feierlich verbrannt. Ich werde dazu tanzen. Nackt.
— Madame de Larenzow (@Larenzow) 4. September 2014
Schule teilt uns per Flugblatt mit, dass Kinder bei manchen Infektionskrankheiten daheim bleiben müssen, am Ende der Liste: „(z.B. Ebola)“.
— Rochus Wolff (@rrho) 4. September 2014
Geschäftsmodell: Entfernung von Kindernamentattoos für Eltern von Pubertierenden.
— Magnus MacNiemann (@grindcrank) 5. September 2014
Der kleine Sohn hat gleich zum ersten Mal Eurythmie in der Schule. Er denkt, es handele sich um eine Art Kampfsport.
— Victoria (@VictoriaHamburg) 5. September 2014
Manchmal muss man als Mutter unfreiwillig andere Mütter und Väter treffen. Im Schwimmkurs zu Beispiel. Das ist nicht schön.
— doppelleben (@hochfrequent) 3. September 2014
Ausschlafen hat seinen Preis. Die Kinder essen seit 1 Stunde Salzstangen. Der Spur nach zu urteilen wandern sie ziellos in der Wohnung umher
— ypsn (@Gehirnkram) 6. September 2014
Wenn die Sechsjährige mir aufgeregt von ihren Erlebnissen erzählt, verstehe ich so viel, als sähe ich „Mulholland Drive“ rückwärts.
— Gebbi Gibson (@GebbiGibson) 6. September 2014
„Mama, du musst auf die Sachen bestehen, die du gesagt hast. Sonst ist das keine Erziehung.“
— Patricia Cammarata (@dasnuf) 8. September 2014
„Darf ich Deinem Sohn ne Brezel kaufen? Oder gibts da ne Allergie oder Erziehungsprinzipien, die dagegen sprechen?“ „Hamwa beides nicht.“
— Madame de Larenzow (@Larenzow) 8. September 2014
„Mit wem spielst du denn in der KiTa am liebsten?“ „Mit den Autos.“ Die soziale Ader hat der Zweijährige von mir geerbt.
— Gebbi Gibson (@GebbiGibson) 9. September 2014
„Junior, wenn du das Holzschwert mitnimmst zum KiGa, musst du mir versprechen keinen damit zu hauen!“ – „Dann kann ich es ja hier lassen.“
— hannapopana (@HannaPopana) 8. September 2014
Die Kindererziehung ist heute viel anspruchsvoller als früher. Früher, zum Beispiel, hatte ich keine Kinder.
— Rita Kasino (@RitaKasino) 12. September 2014
„Und dann bimmeltse mit dem Glöckchen und wer nicht leise is fliegt raus.“ „Mhm.““Glöckchen ey.“ „Mh.“ „Bebikram.“ „Mh.“ „Hupe wär besser.“
— alles b. (@alles_b) 12. September 2014
Die Kinder haben heute eine Katze beerdigt. Wenn Archäologen in 1000 Jahren das Grab finden, denken sie bestimmt, da liegt die Zarenfamilie.
— Sophistikaethe (@Sophistikaethe) 12. September 2014
Umgestaltung Tochterzimmer. Denke, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Ich zum Beispiel hab ne Rolle schwarze Müllsäcke in der Hand.
— Mrs. Van de Kamp (@KleineHyaene) 13. September 2014
Kinder freundlich aus der Küche: „Isst man das Angebrannte mit, Mama?“ „DAS SIND RÖSTAROMEN VERDAMMT!“ (Es tut so weh Mutter zu sein!)
— Patricia Cammarata (@dasnuf) 14. September 2014
Wir aramsamsamen gerade.
— Bobby K. (@DylanDogger) 14. September 2014
Wenn die Eltern endlich alle in ihre Smartphones starren würden, könnten die Kinder hier am Spielplatz in Ruhe spielen.
— Patricia Cammarata (@dasnuf) 15. September 2014
Helen, Helena, Helene, Elin, Ella, Eleni. Sprechen Sie die Namen fehlerfrei aus und ordnen Sie sie korrekt den Freundinnen Ihrer Tochter zu.
— Madame de Larenzow (@Larenzow) 16. September 2014
Manchmal muss ich dran denken, wie ich als 9jähriger eine Demo gegen die Schule organisierte, auf der ich dann allein mit einem Plakat stand
— Caspar C. Mierau (@leitmedium) 17. September 2014
„So, ihr geht jetzt mal bitte Zähneputzen, ohne dass ich das extra ansage!“ – Elternsein fühlt sich oft recht sinnlos an.
— Magnus MacNiemann (@grindcrank) 18. September 2014
Ich bin übrigens diese eine Mutter, die nicht weiß, wie ihr Kind am besten Lesen lernt und das deswegen kommentarlos der Schule überlässt.
— Madame de Larenzow (@Larenzow) 19. September 2014