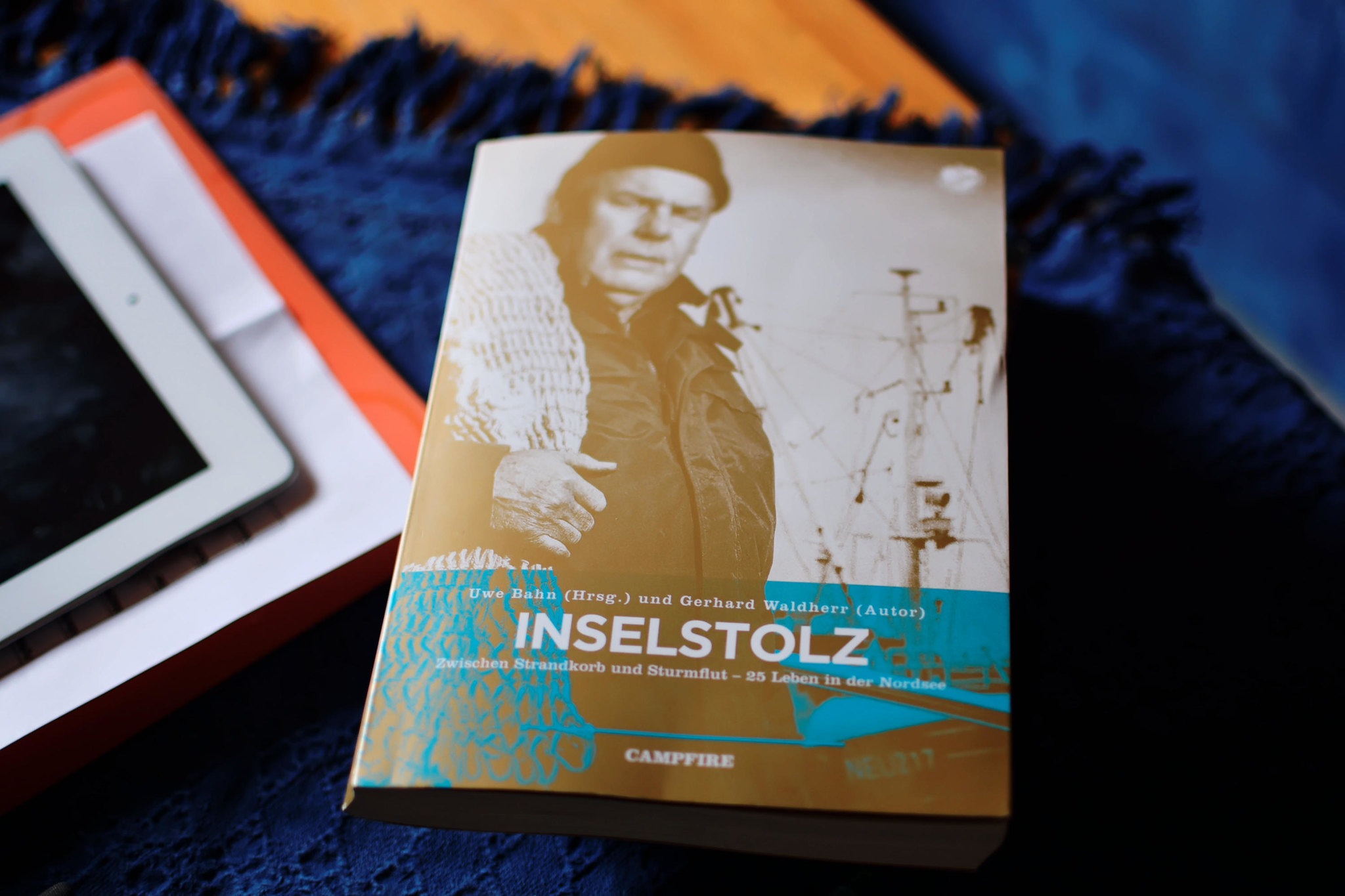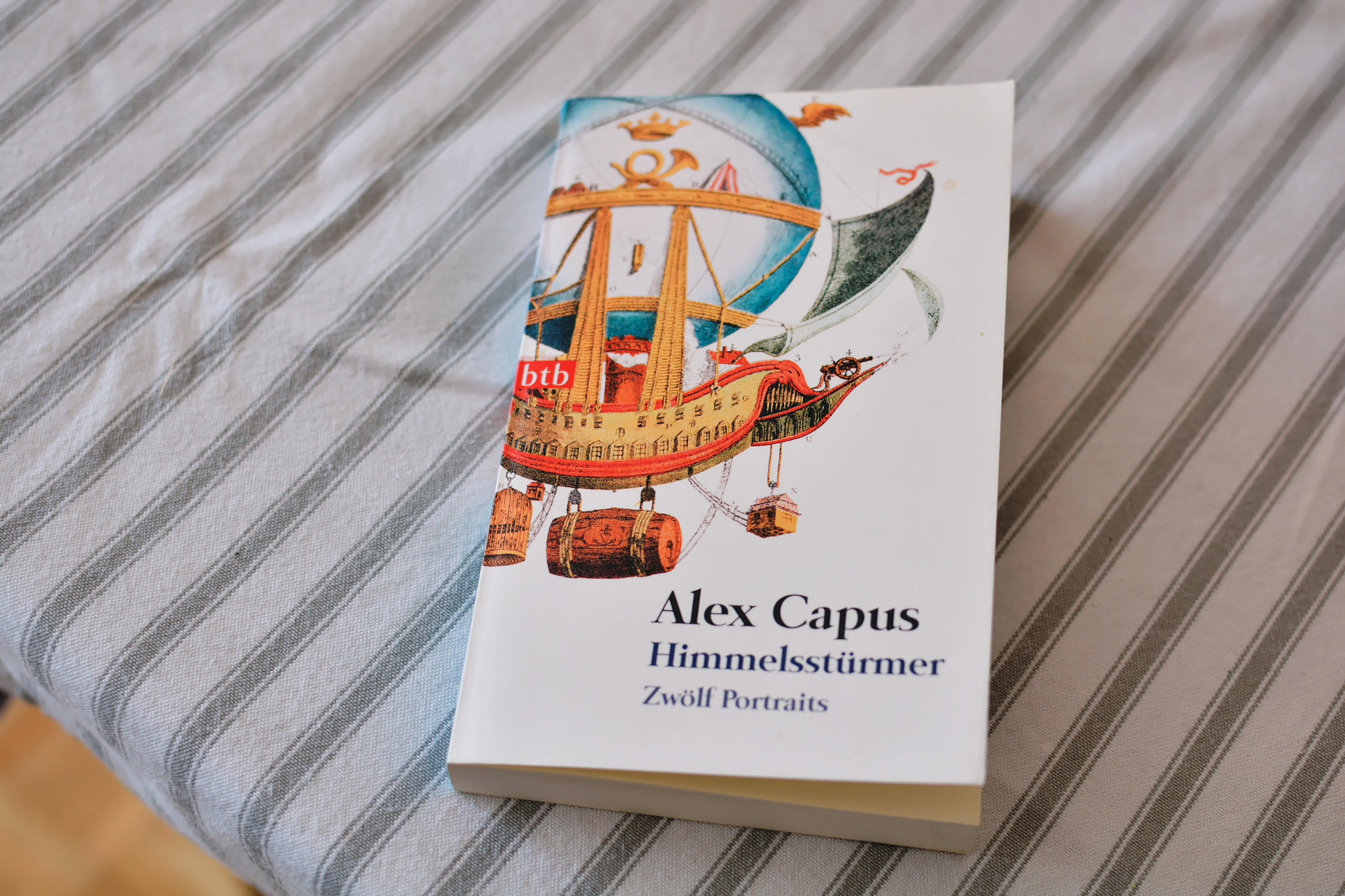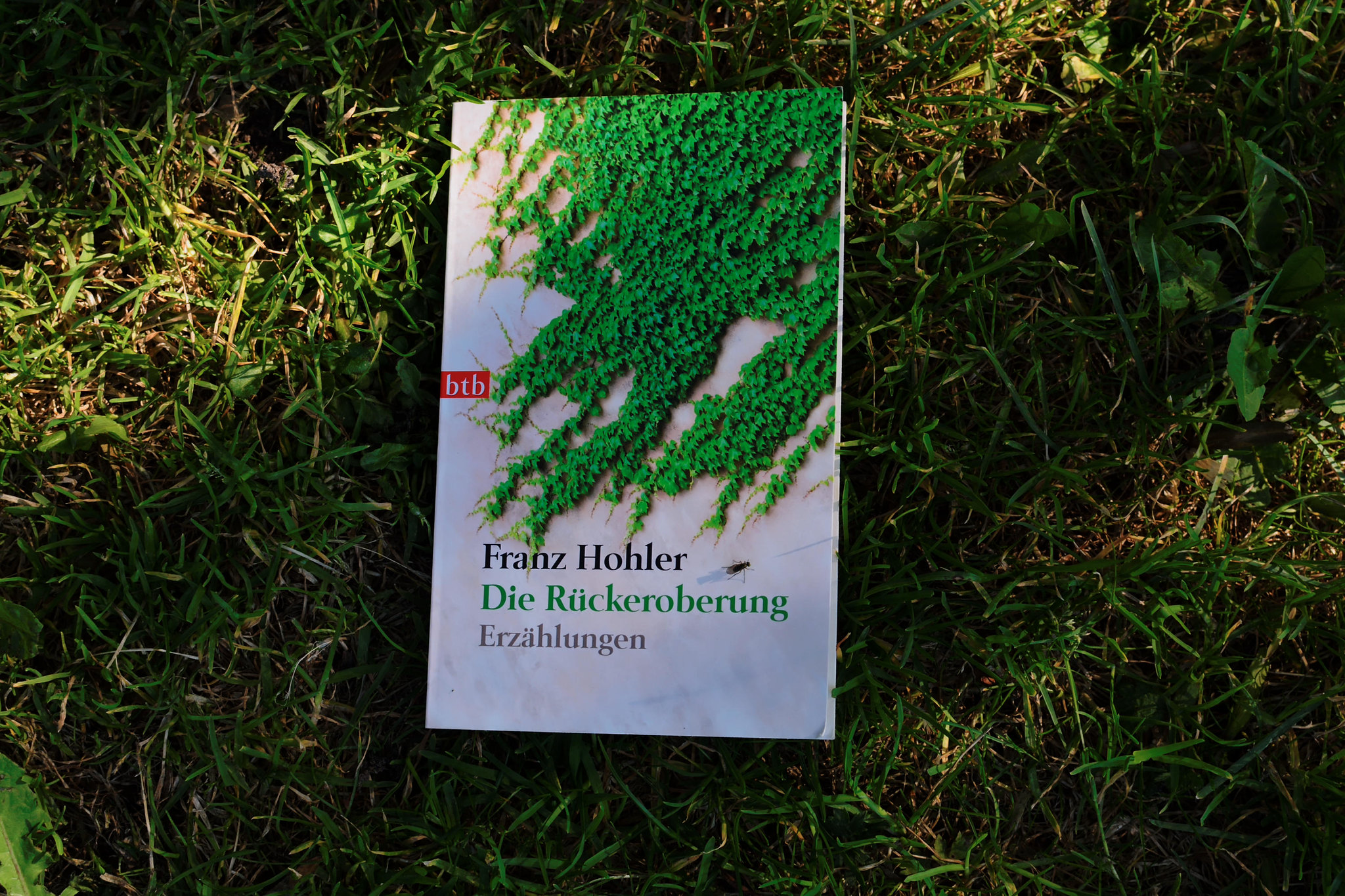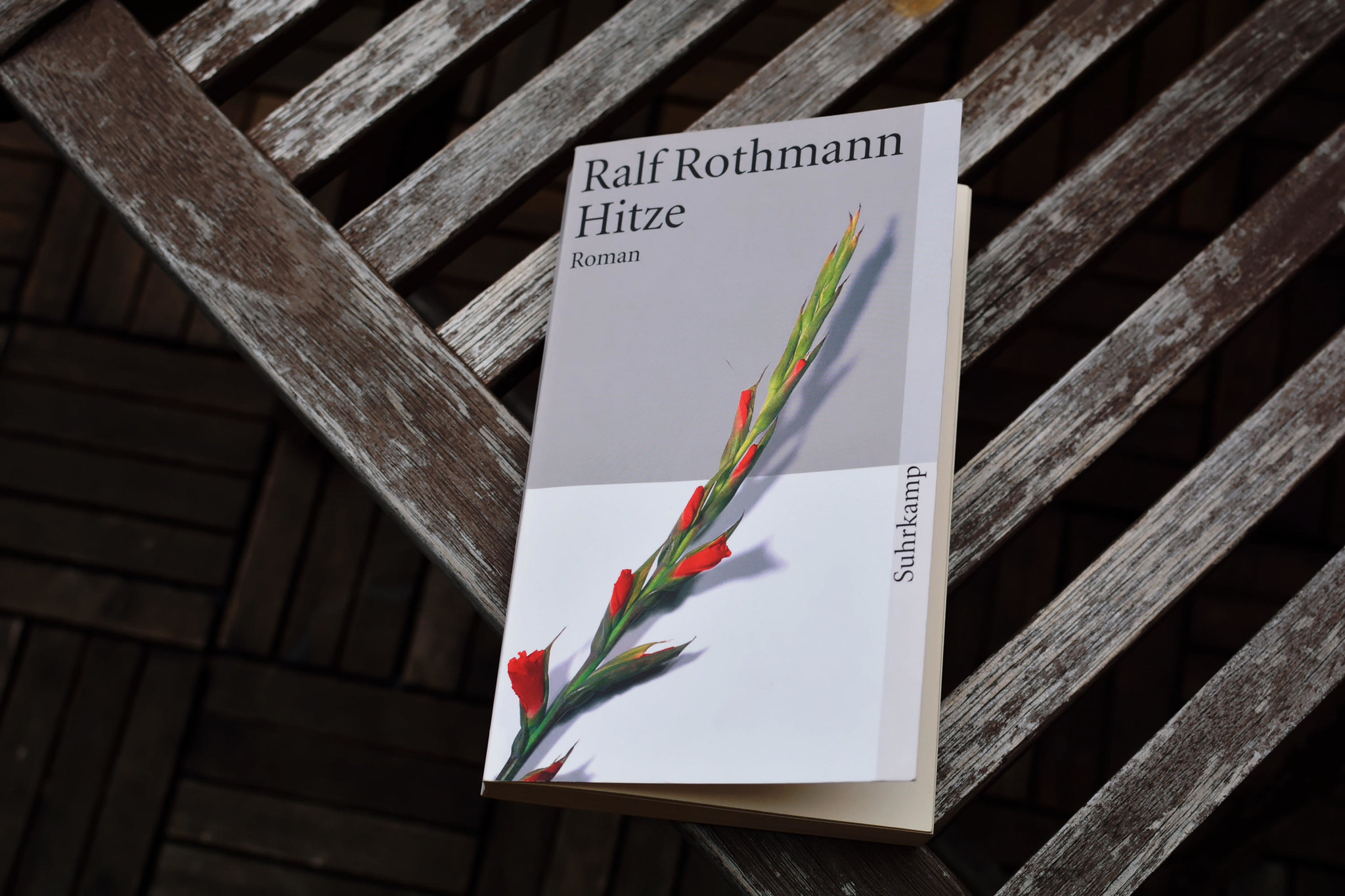Seit Tagen starre ich immer wieder stundenlang die Timelines an. Sie halten mich vom Schreiben und vom Denken ab, diese Nachrichten von brennenden Flüchtlingsheimen und Rechtsextremisten einerseits, die Berichte von Menschen, die Flüchtligen helfen andererseits. Ich komme nicht mehr hinterher und fühle mich überrollt, das passiert mir gar nicht so oft, es ist mir jahrelang nicht passiert. Man kann vor Twitter einfach sitzenbleiben und die Texte und Links durchrauschen lassen, wenn man eine oder zwei Stunden wartet, ist schon wieder etwas Furchtbares passiert. Gleichzeitig kann man auf Facebook nachsehen, was die Hilfsgruppen in der eigenen Stadt auf die Beine stellen, und gerade in Hamburg kann sich das auch sehen lassen, gar keine Frage.
Zwischendurch eine Eilmeldung der Tagesschau auf dem Handy, man öffnet so etwas im Moment mit einem gewissen Grusel – und dann ist es vielleicht nur irgendein Sportquatsch, dem Himmel sei Dank. Da freue auch ich mich einmal über Sport, es ist selten genug. Oder, wie gestern, ist es doch wieder das Grauen. Ins Bett gehen und am Morgen nachsehen, was nun wieder passiert ist. Und ja, es ist etwas passsiert, und morgen vermutlich wieder, da muss man sich nichts mehr vormachen. Die Lage ist jetzt so.
In etlichen Blogs stehen gerade Artikel zu dieser aktuellen Lage, darunter auch etliche Berichte von Menschen, die irgendwo helfen. Auf vielen Seiten stehen Geschichten über vertriebene Großeltern oder Urgroßeltern, über Fluchterfahrungen in der eigenen Familie, da geht es um Ostpreußen und Pommern, da geht es um Rumänien und um andere Gebiete, um ungezählte Parallelen, es ist auch vollkommen egal. Flucht ist Flucht, übrigens auch aus einem sogenannten sicheren Drittland. Die Großmutter der Herzdame kam damals aus Pommern, dazu gehört ein langer Bericht, der reicht für viele Albträume, ich kenne ihn teilweise. Das sind Geschichten, die jetzt überall erzählt werden, manchmal leider eine Generation zu spät. Aber doch besser spät als nie. Es ist nicht einfach, solche Geschichten ohne Pathos zu erzählen, denn es sind große Tragödien und es geht um die ganz großen Themen.
Das Folgende spielt vor etwa zwanzig Jahren.
Ricardo, zu dessen Familie ich einmal gehörte, saß mir abends am Esstisch gegenüber. Wir sprachen über Literatur, wie wir es häufig taten, es ging um die Erzählungen von Stefan Zweig. Man konnte gut mit Ricardo diskutieren, er war belesen und neugierig. Ein älterer Mann, der sich bewundernswert gut in der Nachrichtenlage auskannte, viel besser als ich, er war in vielen Themengebieten bewandert und hatte viele, viele Reisen hinter sich. In seinem Arbeitszimmer stapelten sich die Spiegeljahrgänge, gewissenhaft gelesen und gebündelt. Morgens die dünne Regionalzeitung als Pflichtlektüre zum Frühstück, und er hätte abends nie freiwillig eine Tagesschau oder den Weltspiegel versäumt, damals war der Medienkonsum noch in allgemeingültigen Timeslots organisiert. Die Bücherwand im Wohnzimmer war sehr respektabel bestückt, auch mit Grundlagenwerken der Politik, der Philosophie und der Wirtschaft, und die standen da nicht als Deko, die waren durchgearbeitet und zerlesen. Ich war jung, es war kurz nach meiner Zeit im Antiquariat, ich war also randvoll mit Wissen über Literaturgeschichte und Dichter, mehr aber auch nicht. Ich war sicherlich etwas anstrengend in meiner daraus entsprießenden Weisheit, in mir war alles noch Theorie und Lehrbuch und Größenwahn. Wie man eben ist, wenn man noch nicht allzu viel erlebt, aber umso mehr schon gelesen hat.
“Stefan Zweig”, sagte ich, “dem hat Marcel Reich-Ranicki ja einmal parfümierte Prosa unterstellt.” Und ich freute mich, dass ich das wusste, so ein charmantes kleines Zitat, mit dem man einen bekannten Dichter mal eben komplett abschießen konnte, so etwas mochte ich. Parfümierte Prosa, was für eine gelungene Formulierung. Ricardo, das merkte ich erst nach einer Weile, Ricardo hörte mir gar nicht mehr zu. Er hatte das Buttermesser aus der Hand gelegt, sah aus dem Fenster in den dunklen Garten und hatte Tränen in den Augen. “Stefan Zweig”, sagte er nach einer Weile leise, “Stefan Zweig war ein so dermaßen netter Mensch. So höflich und hilfsbereit.” Und ich brauchte dann ziemlich lange, um zu verstehen, dass er ihn gekannt hatte.
Ricardo war als Jugendlicher aus dem Deutschen Reich geflohen, mit seiner engeren Familie, damals trug er noch einen anderen, einen deutschen Namen, er ist nicht schwer zu raten. Sie flohen in letzter Sekunde und es war knapp. Sie hatten guten Grund für die Flucht, von der großen Familie haben nur etwa sechs Personen die Nazizeit überlebt. Der Rest starb in den Lagern. Sie flohen damals nach Südamerika, wo Ricardo ein paar Jahre später an einer Exilzeitung mitarbeitete, dort hat er auch Stefan Zweig kennengelernt, der manchmal ebenfalls für dieses Blatt schrieb.
Erst mit diesem Gespräch habe ich verstanden, und das war tatsächlich ein Schock für mich, dass die ganze Exilzeit, diese ganze Exilliteratur, etwas von gerade eben war. Das war gar nicht lange her, das lag nicht etliche Generationen und Zeitalter zurück. Das war gestern, dass Menschen weltweit gegen Nazis gekämpft hatten, vor ihnen geflohen waren. Menschen aus meinem direkten Umfeld erinnerten sich noch daran, an die Zeit, an die Erlebnisse, an die Schrecken, an alles. Menschen um mich herum wussten das alles noch – sie sprachen nur nicht darüber. Nicht in dieser Familie, nicht in anderen. Das habe ich natürlich auch vor diesem Gespräch gewusst, ich hatte es nur nicht wirklich verstanden, es war nur Theorie für mich. Das Gespräch an diesem Abend hat mein Weltbild verändert, ich habe die Exilliteratur nach diesem Gespräch ganz anders gelesen. Ich habe Geschichte anders empfunden, ich habe meine Einsortierung in die Weltgeschichte anders wahrgenommen. Und ich bin wohl ein wenig aus der Arroganz der Gegenwart, aus den lustigen Neunzigern gefallen.
Ricardo reiste gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zurück nach Deutschland, er wollte hier die Demokratie aufbauen, vielleicht auch Bundeskanzler werden oder wenigstens Minister. Das war nicht ironisch oder anmaßend gemeint, das fand er selbstverständlich, das war eben ein Gebot der Stunde. Was sollte man denn mit dem brachliegenden Land schon tun? Es musste ja vorwärts gehen, die Geschichte musste vorwärts gehen, also auch dieses zerstörte Land, dessen Sprache er nun einmal praktischerweise konnte. Und da fehlten doch sicher Menschen, die sich für den demokratischen Neuaufbau einsetzten. Also reiste er los. Seine Familie fand das allerdings nicht so naheliegend, er kam ganz alleine zurück.
Er war ein Mann, der für seine Ideale lebte, er war Demokrat durch und durch, er war Sozi, er war Pazifist. Er arbeitete mit heiligem Ernst an der Umsetzung seiner Ideale, obwohl er hier dann doch nur in der Lokalpolitik landete, nicht in Bonn. Er hat seine Aufgaben aber nicht geringgeschätzt, er fand, dass auch der kleinste politische Schritt mit Überzeugung und Einsatz gegangen werden musste. Er ging in seine kleinen Ortsverbandssitzungen im hintersten Winkel der Provinz wie in den Bundestag, er machte da keinen Unterschied. Er war auf diese Sitzungen bestens vorbereitet, er war umfassend informiert, er machte seine politischen Gegner wahnsinnig mit seinem unermüdlichen Einsatz. Er rechnete die Kosten für ein sommerliches Dorffest oder eine neue Straßenbeleuchtung am Sportplatz durch, wie er auf anderer Ebene auch die Entwicklungshilfe für Nicaragua durchgerechnet hätte, nämlich bis zu einem vernünftigen und vor allem verhandelbaren Ergebnis. Wenn die Aufgabe sinnvoll war, dann musste sie eben jemand machen, und im Zweifelsfall war er es. Er glaubte an keinen Gott, aber er glaubte an den Menschen und daran, dass Geschichte ein Ziel hat. Ein utopisches Ziel vielleicht, aber doch ein Ziel. Eine freie, gerechte, soziale Welt. Und wenn man ihm halb im Scherz erklärt hätte, dass dieser Glaube wohl auch eine Religion ist, er hätte den Witz nicht einmal verstanden. Er war kein humorvoller Mann, das nicht. Er meinte es ernst, er war ernst. Er war eher der Hans-Jochen-Vogel-Typ eines Sozialdemokraten, nicht Willy Brandt mit Gitarre und Damenbegleitung.
Er arbeitete also in der Lokalpolitik und am Weltfrieden, für ihn war das miteinander verbunden. Er war früh dabei, als man hier zu Zeiten der Friedensbewegung auf die atomwaffenfreien Zonen kam, dabei war er überhaupt kein Hippie-Freak, kein Spinner, kein Fundi-Grüner, nicht einmal ansatzweise. Er hatte sich nur überlegt, dass er beim Thema Abrüstung in der Weltpolitik nichts bewegen konnte, wohl aber vor Ort. In seinem kleinen Ortsverband. Er konnte da vielleicht vier von sieben Parteimitgliedern überzeugen, eines nach dem anderen, und so machte er unerschütterlich weiter. Nach dem Ortsverband den Kreisverband, da ging doch etwas. Er hat nicht alles erreicht, was er erreichen wollte, aber er hat auch nicht aufgegeben. Und es liegt sicher auch ein wenig an Menschen wie ihm, von denen es durchaus ein paar mehr gab, dass die Nachkriegsgeschichte in Deutschland so gelaufen ist, wie wir sie kennen. Er hat den Dingen eine Richtung gegeben.
Er war immer bereit, für die Ideale aus seiner Jugend einzutreten, mit einer Geradlingkeit, die man heute nicht mehr kennt, wenn es um Politik geht. Nicht zu lösende Probleme konnten ihn bis zur Besessenheit umtreiben, ich sehe ihn noch grübelnd im Garten auf und ab gehen, weil er nicht auf die richtige Strategie kam, die Welt wieder ein winziges Stück besser zu machen. Er redete mit sich selbst, stand mit verschränkten Armen kopfschüttelnd vor einer Hecke, die jemand dringend hätte schneiden müssen. Für so etwas hatte er weder Zeit noch Sinn, das war nicht sein Thema. Er ging kopfschütttelnd wieder weiter über den Rasen und blieb abrupt stehen, wenn ihm etwas einfiel. Ging irgendwann schnell an den Schreibtisch, die Tür zum Arbeitszimmer flog hinter ihm zu, dann hörte man ihn tippen. Das ist mittlerweile etwas aus der Mode gekommen, so allein mit sich und seinen Gedanken zu ringen, vielleicht ist es schade.
Es konnte in seinen Grübeleien tagelang um engste lokalpolitische Themen gehen, manchmal aber auch um die großen Krisen der Welt. Das war ein Mann, der am Nahostkonflikt verzweifeln konnte, weil er die Lösung nach einer längeren Reise durch die Krisenregionen doch auch nicht wusste. Das war in seinem Weltbild nicht vorgesehen, dass etwas nicht lösbar war. Ich sehe ihn vor mir, mit welcher Irritation er von Israel und Palästina erzählte. Weil er einfach nicht wusste, was zu tun war. Es musste doch einen Weg geben? Er betrachtete das wie ein Schachspiel, und er kam nicht auf den richtigen Zug. Obwohl es ihn geben musste, davon rückte er nicht ab. Er wollte Frieden und Fortschritt und Gerechtigkeit, er wollte das ganze alte SPD-Zeug, von dem heute kaum noch etwas mehr übrig ist. Er war überzeugt, dass die Welt zu verbessern sei, dass sie jetzt sofort und direkt vor Ort zu verbessern sei – und er wäre nicht darauf gekommen, nicht zuständig zu sein.
Er hat in Gaststätten nie mit dem Rücken zur Tür gesessen. Weil man ja nie wusste. Das war eine Folge der Flucht, jede Flucht wirkt ein Leben lang nach.
Mir fällt Ricardo gerade wieder ein, weil er so anders auf Probleme reagierte, als es viele tun. Nicht mit Angst oder Aggressionen und Beleidigungen, nicht mit Pathos, auch nicht mit Hurra und Theaterzauber. Nein, er hat einfach überlegt, wo er anfangen könnte, an der Sache zu arbeiten. Auf seine unspektakuläre, sachliche Art. Und dann ging es eben los. Immer den Idealen nach, weil es doch die einzig mögliche Richtung war.
In den letzten Tagen habe ich oft an ihn gedacht. Morgen, am 29.8., kann man übrigens um 15 Uhr wieder mit den Flüchtlingen aus der Hamburger Messehalle auf dem Karolinenplatz essen und Willkommen feiern. Etwas Essen und Getränke mitbringen, wie zu anderen Partys auch. Einfach so. Ganz unspektakulär.