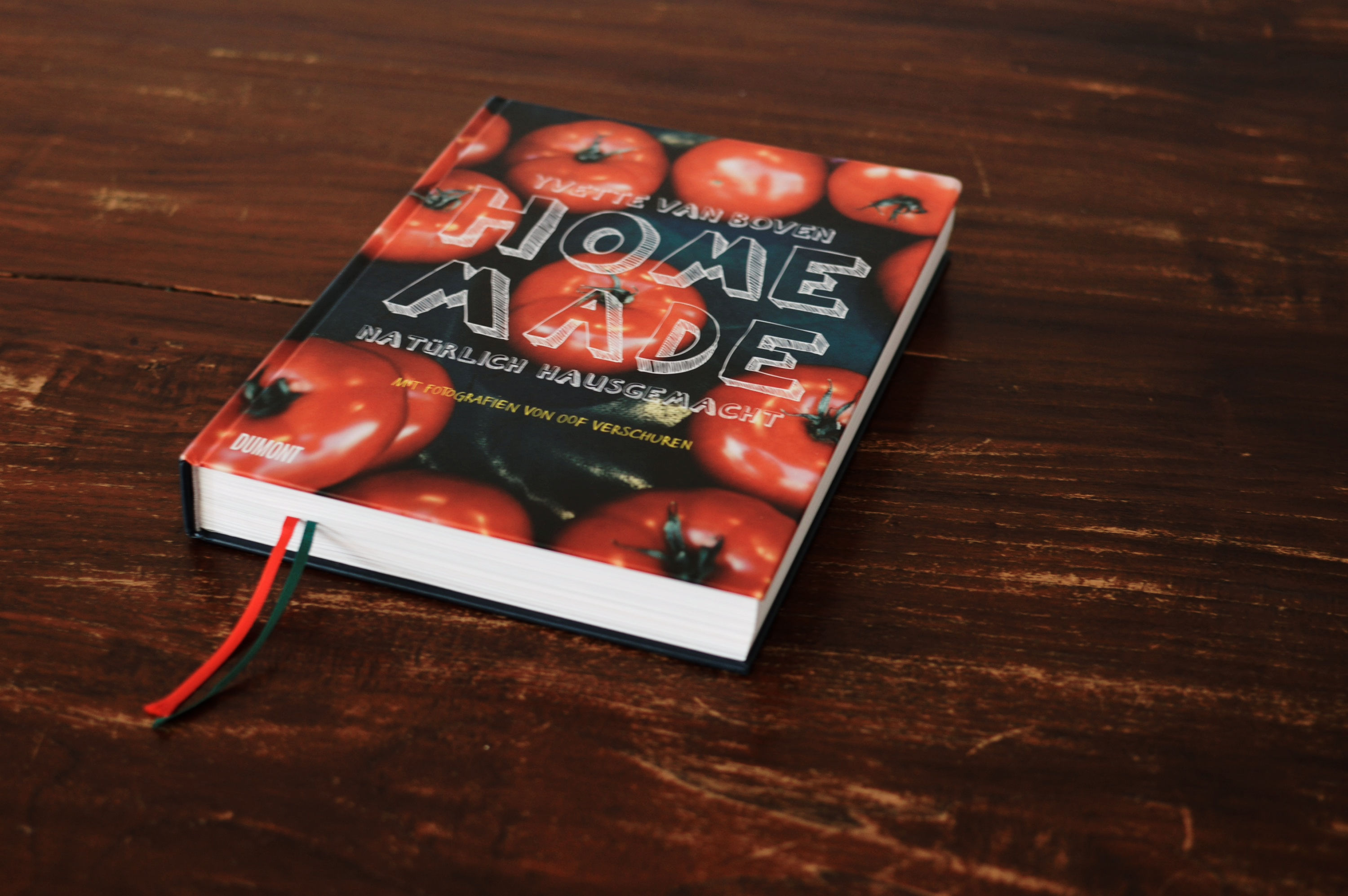Wir wohnen neben einer Kirche und vor der Kirche ist ein Platz, auf dem eine bronzene Kreuzigungsgruppe unter freiem Himmel steht. Früher war sie einmal die letzte Station eines Kreuzweges vom früheren Dom aus, den gibt es schon lange nicht mehr. Die Figuren sind nicht mehr original, aber es sind Nachgüsse eines der ältesten Kunstwerke Hamburgs, sagt zumindest die Wikipedia. Die Figuren von Jesus am Kreuz, von den beiden Trauernden Maria und Johannes und den anderen Gekreuzigten, sie stehen auf hohen Granitblöcken, und die sind tatsächlich noch aus dem Mittelalter.
Vor der Kreuzigungsgruppe steht eine steinerne Bank. Auf der sitzen oft Touristen, die dort gerade stranden, weil sie orientierungslos zwischen Hauptbahnhof, Lange Reihe und Alster nicht mehr weiter wissen und dann eben zum schönen Kirchturm gehen und sich erst einmal hinsetzen. Was man so macht, als Tourist. Sie sitzen dann auf der Bank und essen Fastfood, machen Fotos oder suchen im Reiseführer, was es nun mit dem Kunstwerk da vor ihnen auf sich hat und ob die Kirche irgendwie wichtig ist, ob man die am Ende sogar kennen muss? Ratloses Geblätter, die Kirche kommt längst nicht in jedem Reiseführer vor. Kinder versuchen, an der Kreuzigungsgruppe hochzuklettern. Einige Eltern untersagen es sofort, einige sehen dem gelassen zu. Kleine Kletterkönige legen nach dem Aufstieg den Arm um Jesus und winken in die Kamera.
Manchmal sitzen dort auch Gläubige, manchmal knien sie sogar. Gucken hoch, ernst und lange, die Hände gefaltet. Alte Menschen sind das oft, die da sitzen und beten und den Jesus schweigend ansehen. Der guckt leidend in den Himmel, sie sehen nachdenklich zu ihm. Neben der Steinbank stehen leere Flaschen, weil abends oder nachts jemand dort noch den letzten Schluck genommen hat. Mittags liegen manchmal schlafende Menschen auf der Bank, besonders wenn die Sonne scheint. Das sind manchmal Obdachlose, manchmal aber auch Menschen aus den Büros ringsum, die in der Mittagspause ein Nickerchen machen. Die Bank ist gut besucht.
Ich gehe am Nachmittag dort vorbei, eine junge Frau sitzt auf der Bank. Der Oberkörper schaukelt etwas hin und her, da sieht man schon von weitem, dass sie nicht nüchtern ist. Wenn man näher kommt, hört man ihre Stimme, die verrutschten Konsonanten, die breiigen Vokale, sie klingt wirklich sehr betrunken. Sie sitzt und schaukelt und gestikuliert, während sie mit dem Jesus da oben spricht. Ein friedliches Gespräch ist das aber nicht, es klingt eher nach einer Beziehungskrise – und zwar einer fortgeschrittenen. Sie spricht mit einem deutlichen, sofort zu erkennenden osteuropäischen Akzent. Sie kneift die Augen zusammen, um die Figuren da auf den Granitsteinen besser fixieren zu können, was wohl gar nicht so einfach ist, zumindest schüttelt sie immer wieder wild den Kopf, dass die Haare fliegen, und orientiert sich dann ganz neu. Der Jesus rutscht aber nach einer Weile immer wieder aus ihrem Blick.
“Dein Wille geschehe” ruft sie nach oben und nickt heftig, “Dein Wille geschehe!” Es ist eher ein Befehl als eine Fügung in ein Schicksal, es ist mehr der Tonfall von “Kommst du jetzt nach Hause!” als “In Deine Hände befehle ich meinen Geist” oder dergleichen. Sie ruft das noch einmal und noch lauter, “Dein Wille geschehe!” und dann guckt sie gebannt hin, ob sich da oben etwas rührt. “Jetzt!” ruft sie noch hinterher, dann schweigt sie aber und wartet. Sie erhebt sich sogar ein klein wenig, um näher an dem Angesprochenen zu sein und ihn besser sehen zu können. Das lässt sie dann aber wieder sein, die Welt schwankt doch zu sehr, sie sucht mit beiden Händen tastend Halt. Guckt auf den Boden und atmet durch, hebt dann wieder den Kopf. Sie sitzt und guckt. Sie starrt ihn an, ihn, der sich weiter nicht rührt und immer gleich leidend zum Himmel sieht, über sie hinweg. Zwischendurch dreht sie sich um und folgt seinem Blick, was ist da eigentlich, wo er die ganze Zeit hinsieht? Nichts. Grauer Novemberhimmel über Häusern. Sie dreht sich wieder um und starrt ihn an. Minutenlang sitzt sie so.
Dann atmet sie tief durch und schüttelt den Kopf, vermutlich findet sie, dass die Gesprächspause jetzt unangemessen lang wird. “Ja, was jetzt!” brüllt sie und ist wirklich wütend, dass das nichts kommt. Sie ist außer sich, und wenn sie auch traurig ist, dann sieht und hört man davon nichts, gar nichts. Sauer ist sie, sauer und empört, und so nah an einer Kirche könnte man sogar von flammendem Zorn sprechen.
Denn sein Wille scheint zu sein, dass nichts geschieht. Auch wenn sie den Atem anhält und sich nicht bewegt und ihn einfach nur ansieht und ganz genau hinhört, ihm ganz und gar zugewandt – da kommt nichts. Ist es zu fassen? So geht es ja nun nicht. Sie schüttelt den Kopf, wie man bei einem Streit den Kopf schüttelt, wenn man nicht mehr daran glaubt, dass all die Debatten jemals zu etwas führen können. Sie schüttelt den Kopf, wie man in Beziehungen nach einem langen Streit den Kopf schüttelt, bevor man das Licht ausmacht und unversöhnt einschläft, sie schüttelt den Kopf wie eine Mutter, die das heillos verzogene und bockige Kind doch wieder ohne Abendbrot ins Bett schickt. Sie hat es immer geahnt, das sieht man an diesem Kopfschütteln, dass da nichts kommt. War ja klar.
Sie schüttelt den Kopf aber auch wie jemand, der zu betrunken ist, um sich am nächsten Tag auch nur ansatzweise an die Szene zu erinnern. Sie wird schon Mühe genug haben, nach Hause zu finden. Sie wird am nächsten Tag in keinem guten Zustand aufwachen und nicht mehr viel vom letzten Tag abrufen können. Doch, dass dies so geschehen wird, darauf kann man wetten. Ob das aber sein Wille ist, die Frage kann man den Gläubigen überlassen.