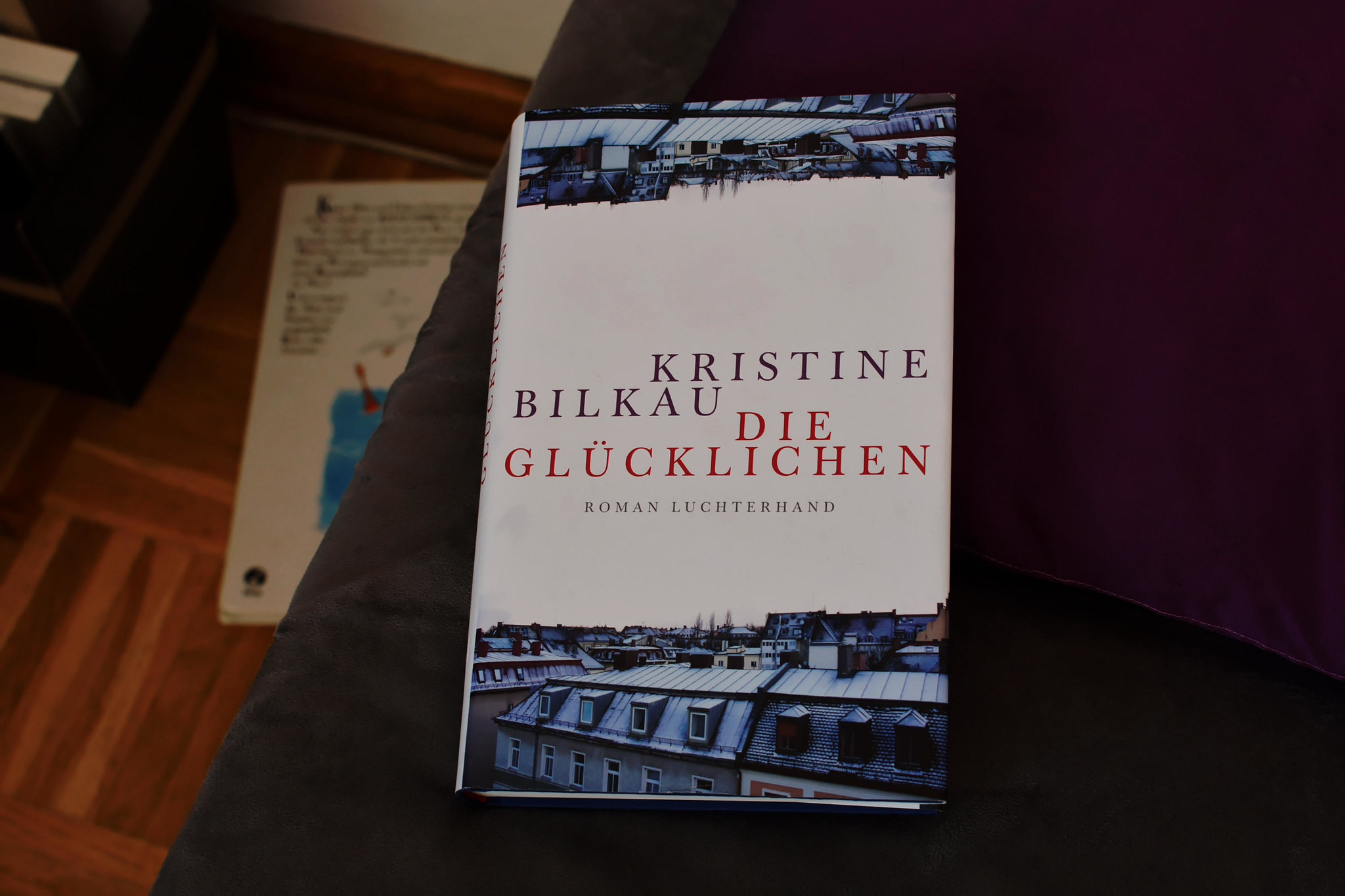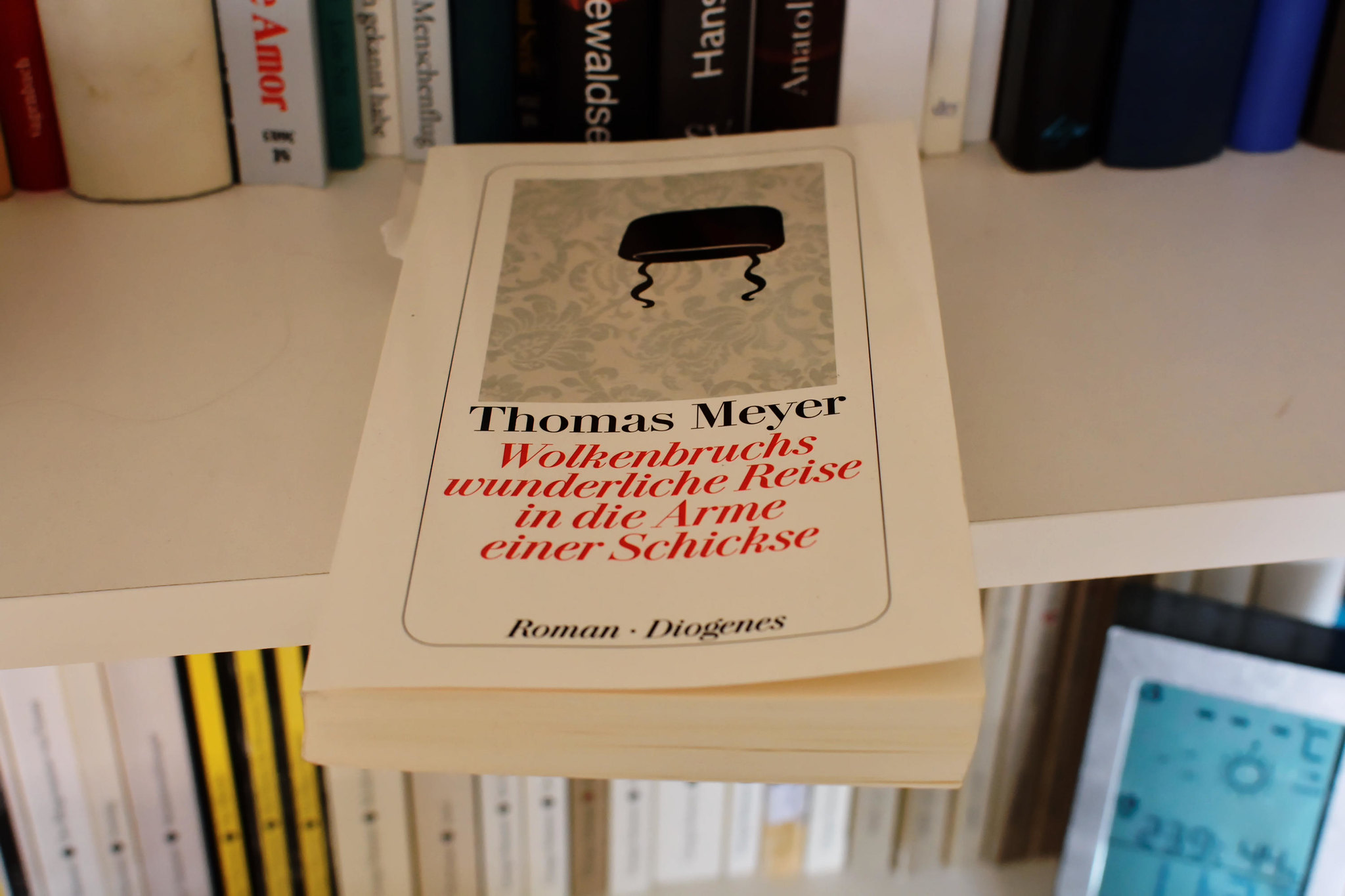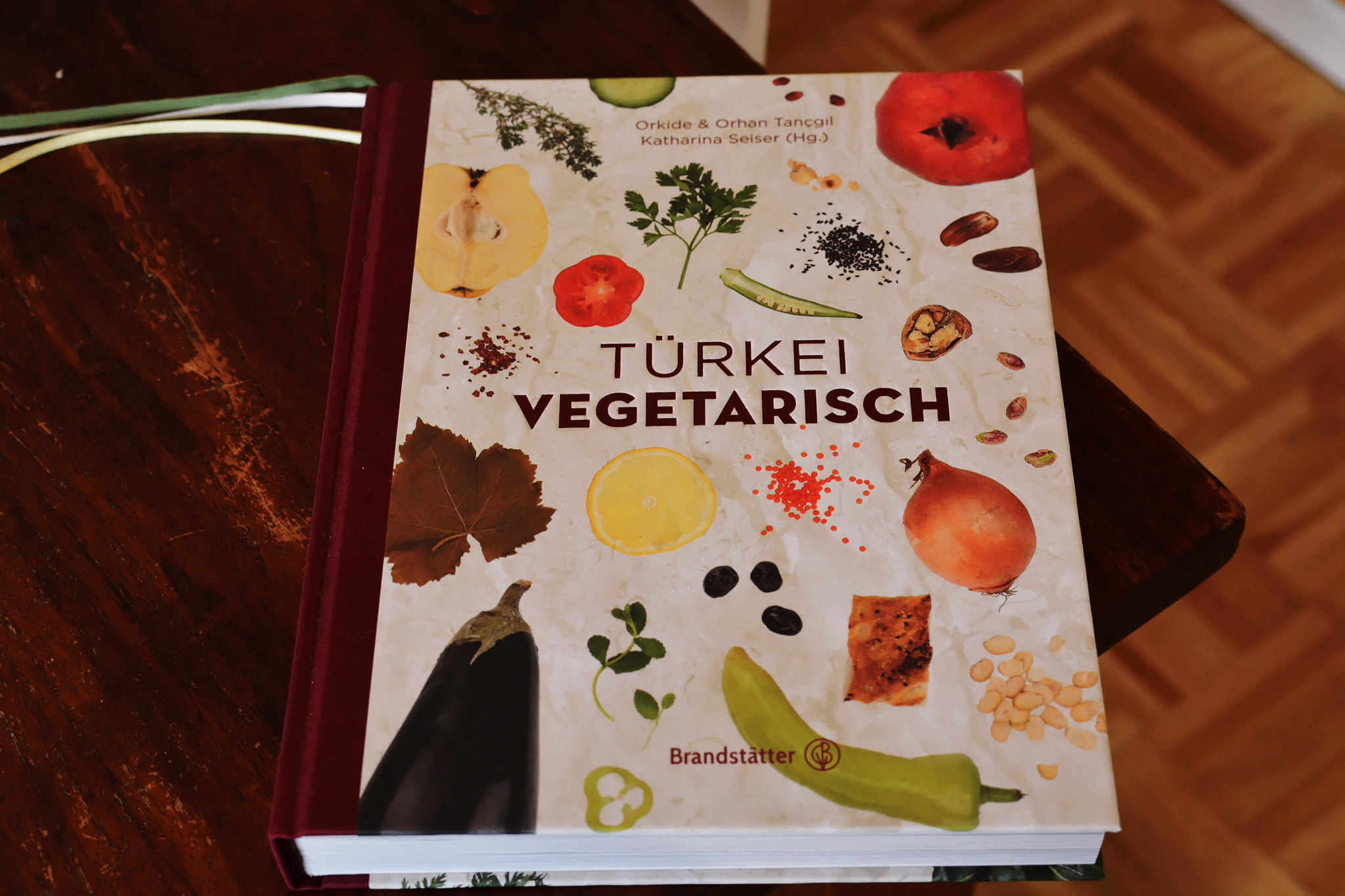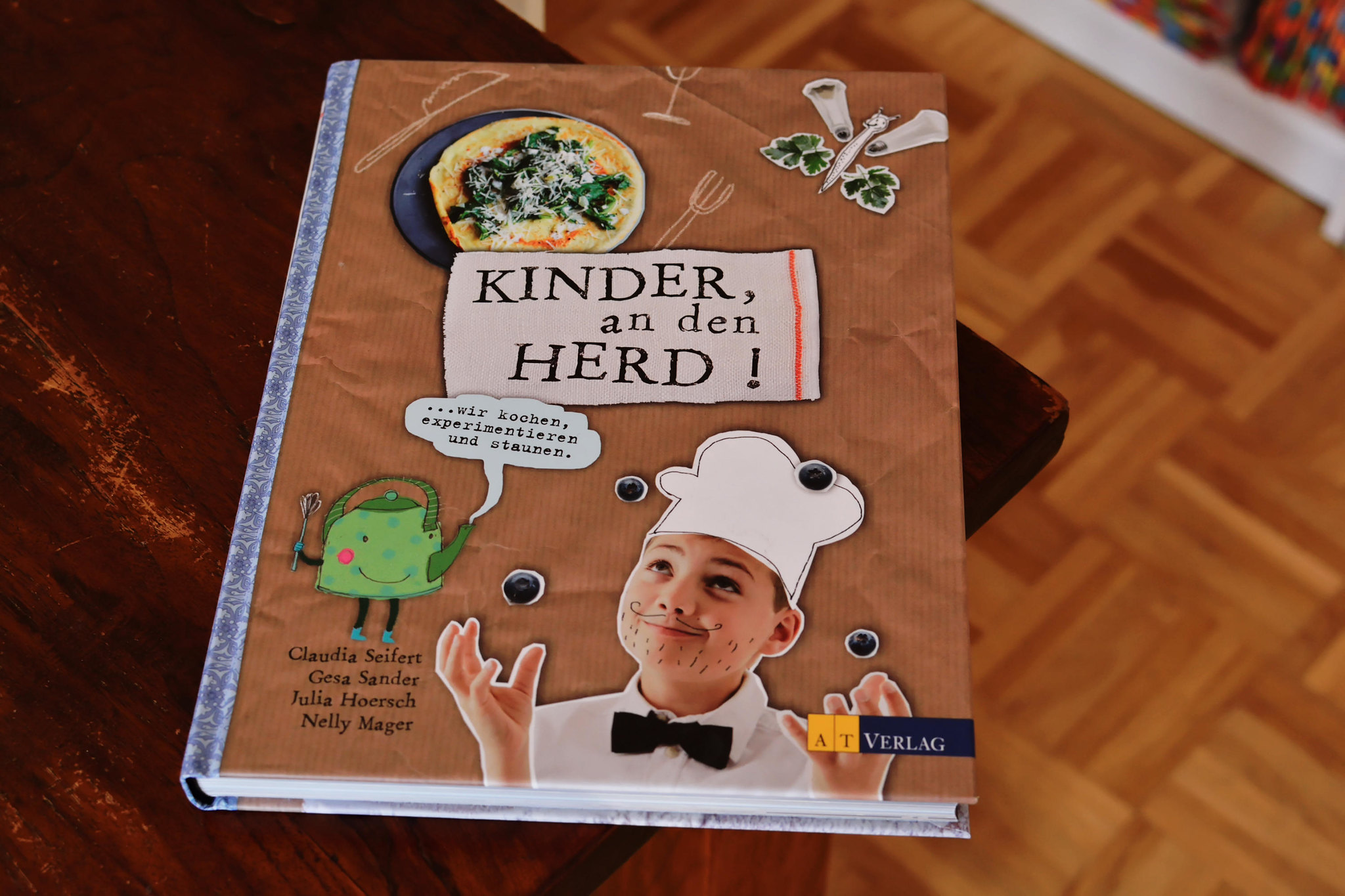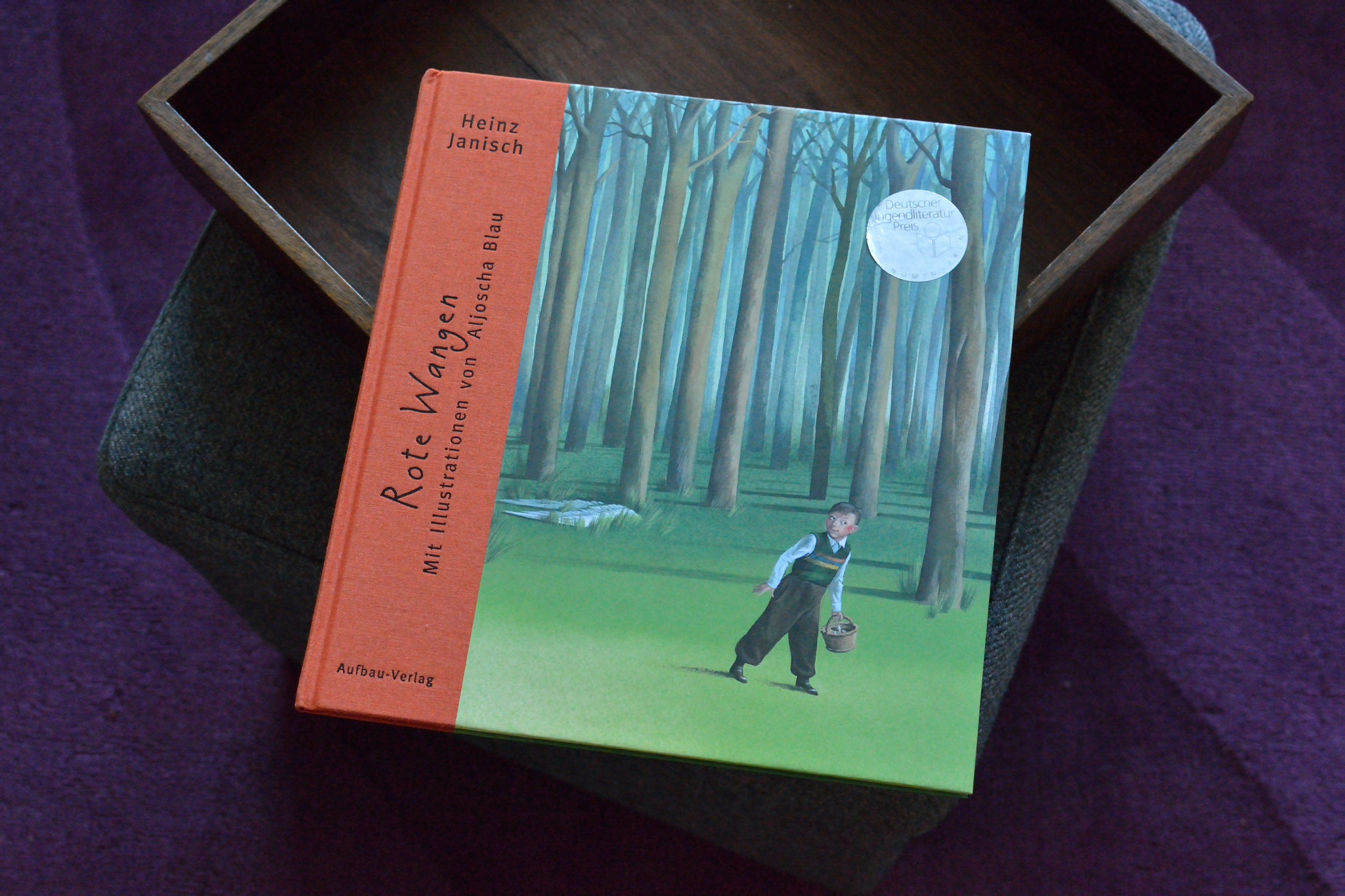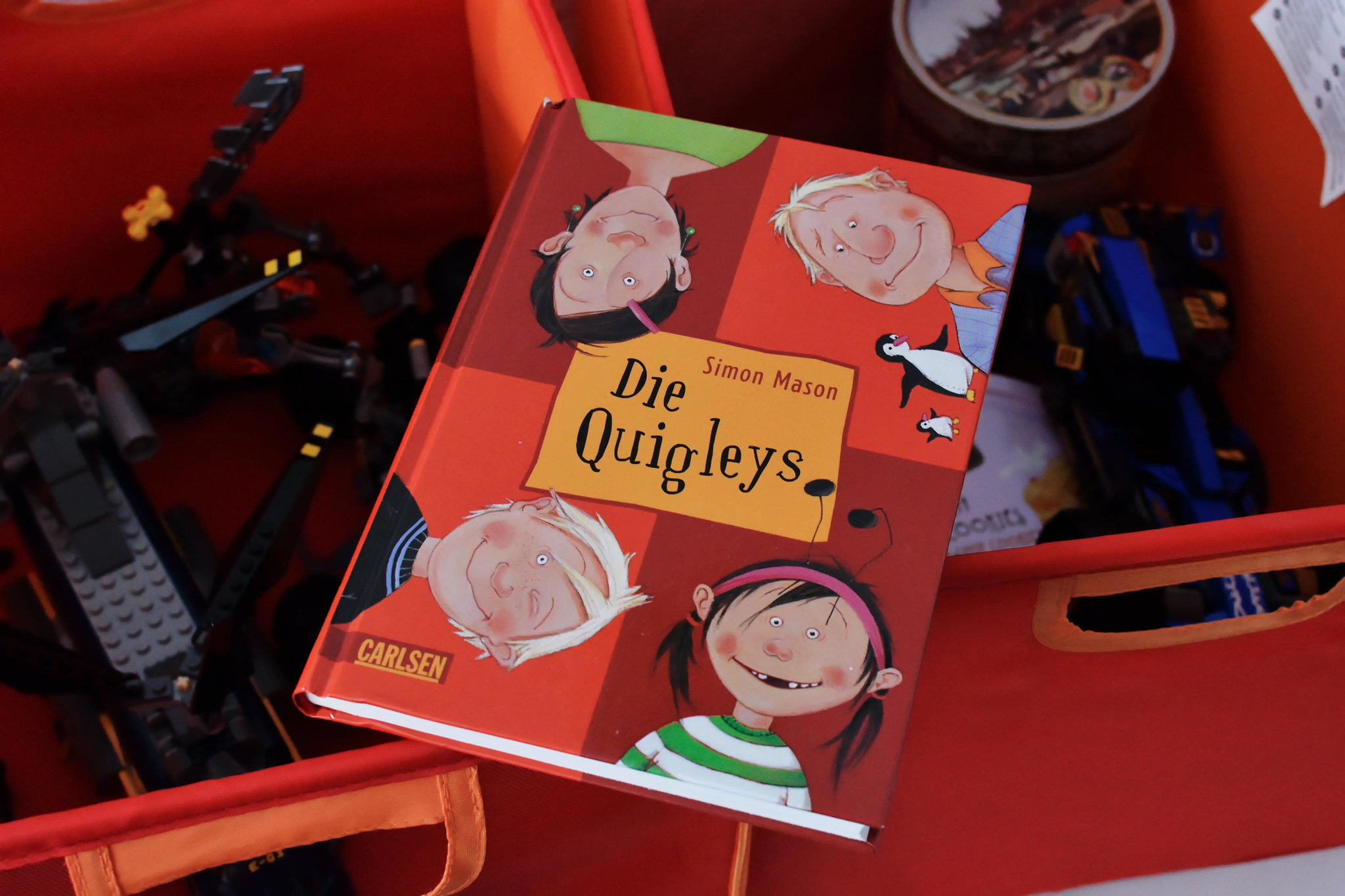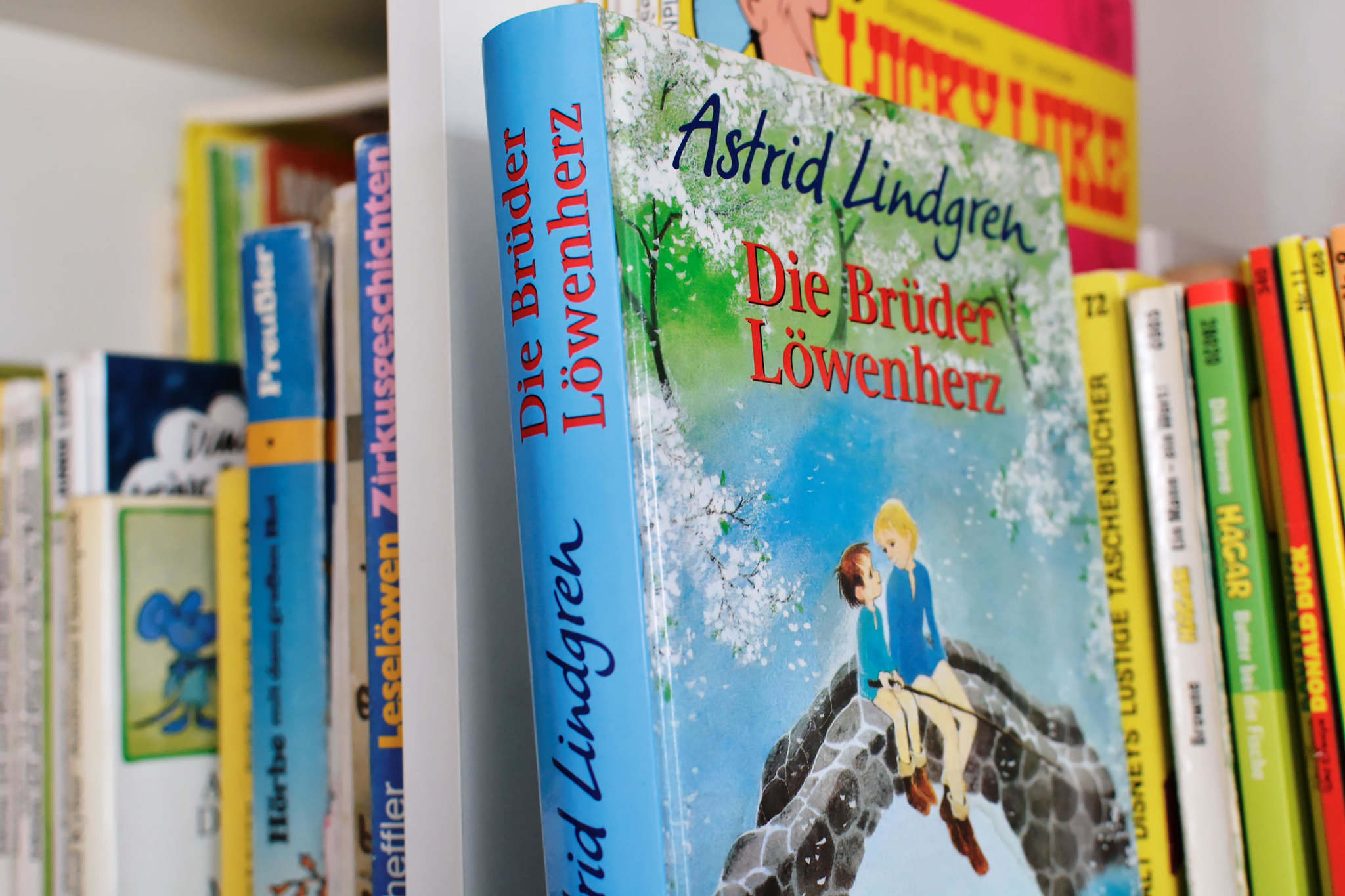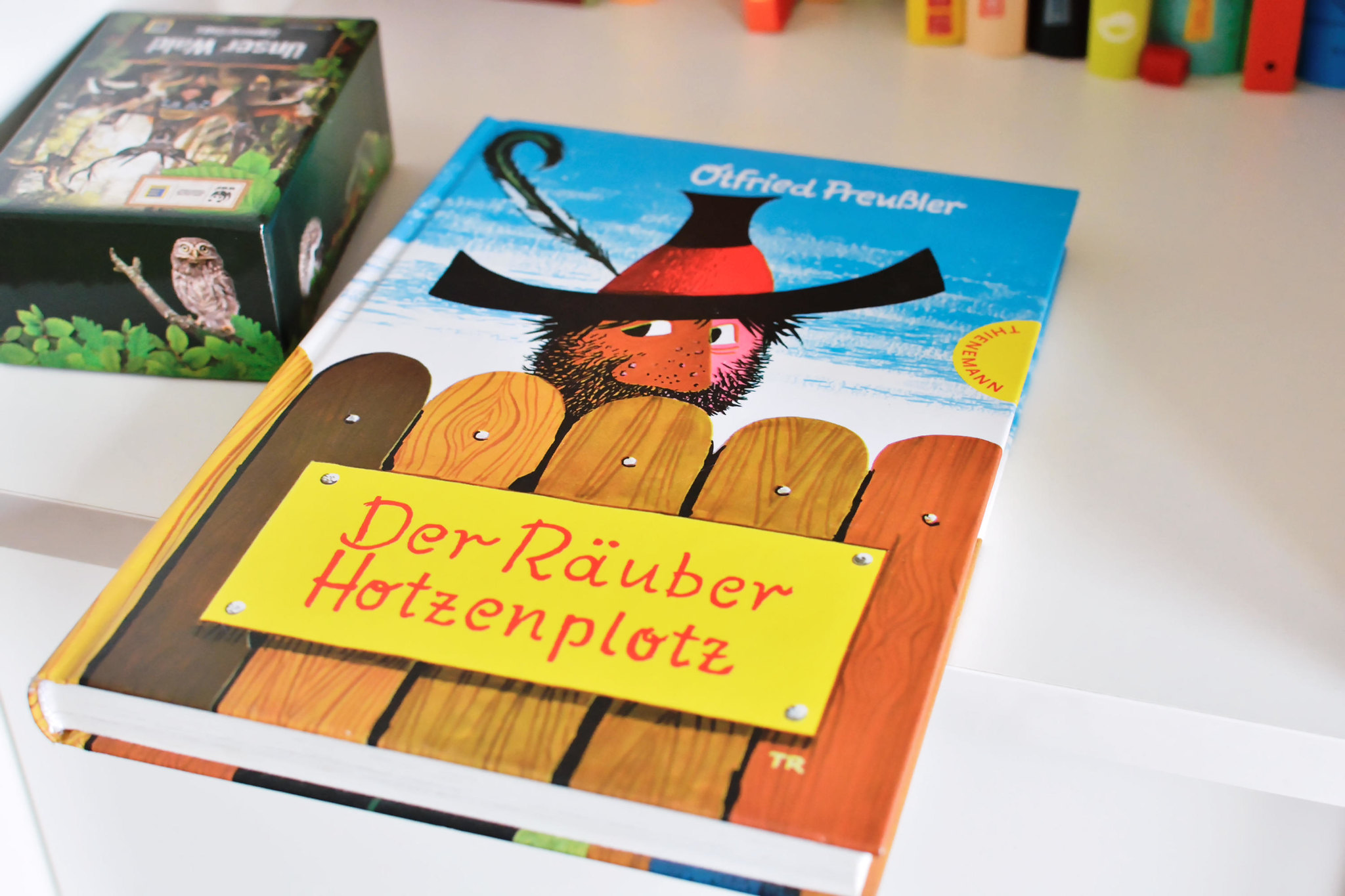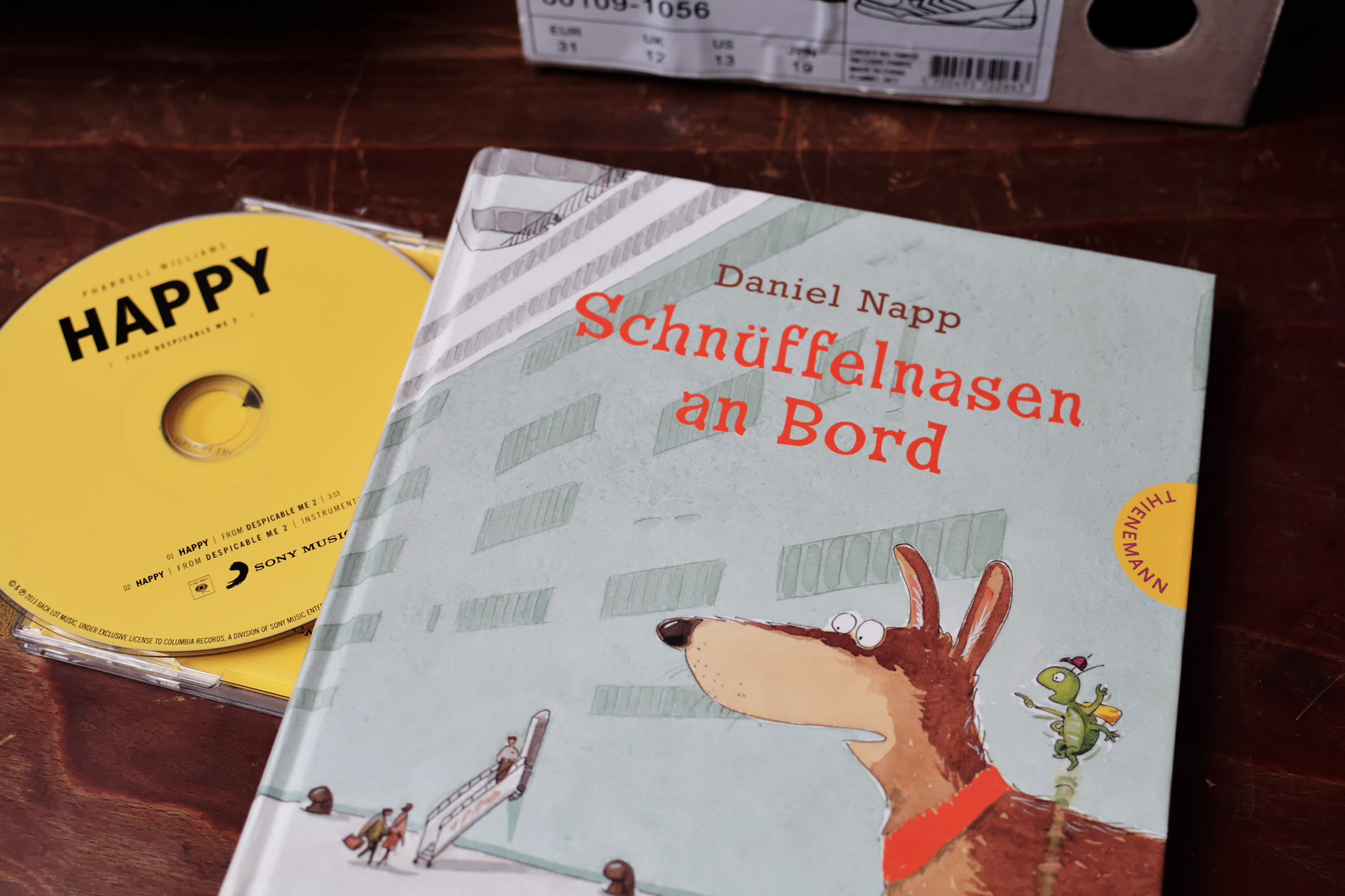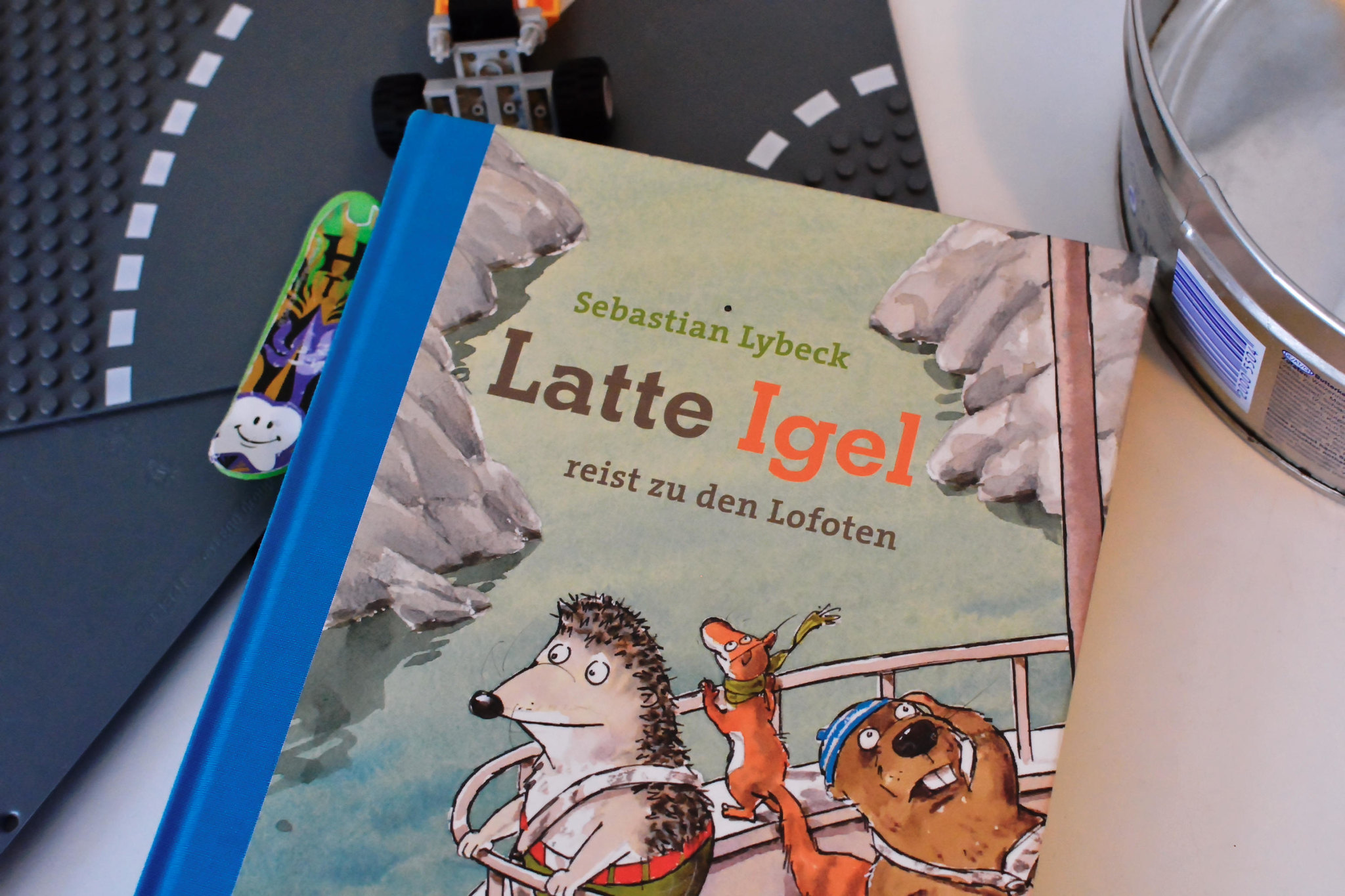Auf dem Bahnhofsvorplatz steht eine geflüchtete Familie, der kleine Sohn ist etwa drei, vier Jahre alt. Sie sind alle müde und verfroren, der Sohn ist aber so müde, dass er kaum noch stehen kann. Er gähnt unentwegt, die Auge fallen ihm dauernd zu, er steht schwankend und taumelnd hinter seinem Vater. Dabei hält er sich an einem der Riemen fest, die von dessen Rucksack herabbaumeln. Seine Hand klammert sich an diesen Riemen, der Vater steht und spricht mit einem der Helfer vor den Versorgungszelten. Er tastet ab und zu nach hinten, ob der Junge noch da ist, streicht ihm kurz übers Haar. Der Junge lehnt den Kopf an den zum Vater hochgereckten Arm und macht die Augen kurz zu, wieder auf, wieder zu, dann bleiben sie erst einmal zu. Der Winterjackenärmel ist weich wie ein Daunenkissen, er würde so gerne schlafen, sicher hat er schon viel zu lange nicht mehr geschlafen. Er schreckt zusammen, wenn sein Arm sinkt, wenn seine Finger sich vom Riemen lösen, den er immer weiter umklammert, ganz, ganz fest. Der Vater geht weiter, hinten auf dem Platz wird Kaffee ausgegeben. Der Kleine trottet hinterher, immer dem Vater nach, dem Rucksack nach, dem Riemen nach, dem eigenen Arm nach, dabei muss man die Augen gar nicht lange aufmachen, immer nur hinterher, er kann mit geschlossenen Augen gehen, er ist so unendlich müde. Es ist schlimm, nicht schlafen zu können, aber es ist noch schlimmer, diesen Riemen loszulassen, durch den er mit seinem Vater verbunden ist, mit den Geschwistern, mit der Familie. Wer weiß, was alles weg ist, wenn er auch nur kurz loslässt.
Ich gehe mit Sohn I am frühen Morgen aus dem Haus, er muss zur Schule, ich ins Büro, wir gehen ein Stück gemeinsam. An einer Hauswand sehen wir ein neues Graffiti, es ist ein ungelenk gesprühter Schriftzug PKK, daneben Hammer und Sichel in der gekreuzten Version, an die man sich als Erwachsener noch dunkel erinnert. Der Sohn fragt etwas erstaunt, ob das Zeichen da ein Buchstabe sei, den würde er ja gar nicht kennen. Ich erkläre ihm die Sache mit dem Hammer und den Arbeitern, mit den Bauern und der Sichel. Er fragt weiter und weiter nach, wir kommen irgendwie auf Monarchie und Revolution und Republik und Kommunismus, auf absolute Herrscher, hungernde Weber und Arbeiter, reiche Fabrikanten und Gutsherren. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Themen auf wenige Meter Schulweg passen, wenn jede Antwort immer noch eine Frage erzeugt. Im baufälligen Gemäuer meiner Allgemeinbildung zieht es bei dem Gespräch allerdings eiskalt durchs morsche Gebälk, hier und da wackelt ein Ziegel, und es wird reichlich Staub in lange verschlossenen Kammern aufgewirbelt. Ich denke hektisch nach, wer war wann und was, was kam wovon und seit wann ist das eigentlich so und wie kann ich das erklären, kann ich überhaupt irgendwas erklären? Wie war das denn damals noch im Schulbuch? Und was hat das mit heute zu tun, mit der PKK in der Türkei, mit den Parteien in Deutschland? Der Sohn und ich landen kurz vor dem Schultor bei den Rechten und den Linken, ich erkläre ihm, wieso die so genannt werden und dass es damals, als das alles in Frankreich anfing, um ganz andere Themen ging, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten vielleicht schon nicht mehr. Oder? Europa diskutiert gerade wieder über Grenzen und es ist der Tag mit dem Beschluss zur Vorratsdatenspeicherung in Berlin, das Volk im Generalverdacht. Im Grunde ist es ein schlechter Witz, wie alles zusammenhängt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, man möchte direkt lossingen. Ich höre mich über geschichtliche Zusammenhänge reden, ich müsste aber selbst mal wieder dringend darüber nachdenken. Vielleicht wäre es angebracht, wieder in ein Geschichtsbuch zu sehen, man sollte sich nichts auf sein Halbwissen einbilden. Der Sohn fragt nach den Rechten und den Linken, er findet es blöd, dass die Rechten böse sind. Denn als Rechtshänder findet er rechts eigentlich okay. Es wäre ihm lieber, wenn man die Rechten die Linken nennen würde.
Die Söhne reden beim Einschlafen über Flüchtlinge, über die Spendenaktionen bei Edeka und Budni. Die Lage am Bahnhof ist hier dauernd Gesprächsthema, weil man die Menschen vor unserer Haustür nun einmal nicht übersehen kann. Sohn II sagt: “Man kann für die Flüchtlinge Sachen kaufen und dann spenden. Aber wenn man alles klauen würde, das wäre mehr Robin Hood.”
Ich gehe mit der Herzdame auf den verregneten Wochenmarkt und frage Händler mit wetterbedingt novembriger Laune nach Gemüsespenden für die Suppenaktion. Für die Welcome Soup St. Georg, die hier von Eltern und anderen jeden Tag hundertliterweise zubereitet wird, damit die durchreisenden Flüchtlinge am Bahnhof etwas Heißes essen können. Da muss man sich schon ein wenig überwinden, einfach so fragen zu gehen, das macht man sonst nicht. Können wir den Chef sprechen? Können Sie noch einmal etwas spenden? Für die Suppenküche? Bitte? Lächeln, weiter lächeln, fragende Blicke aushalten, die Herzdame kann das viel besser als ich, das ist nichts für mich. Aber die Händler machen mit.
Ich gehe abends über den Steindamm, ich habe hier schon einmal über diese Straße geschrieben, die nicht wie andere Straßen ist. Es ist kalt und es regnet, ich habe eine Mütze und eine Kapuze auf, ich sehe wie durch einen Tunnel, immer nur einen schmalen Ausschnitt der Straße im Blick. Nasses Gemüse und Obst in Auslagen ziehen durchs Bild, viel mehr Sorten als in jedem deutschen Supermarkt, die Schilder daran handgeschrieben in verschiedenen Sprachen, etliche versteht man nicht, einige sind längst im Regen verlaufen. Es gibt in diesen Läden Gemüse, das ich noch nie gegessen habe, eingeflogen aus Afrika oder Indien oder woher auch immer. Riesige Früchte, auf deren Namen ich nicht komme, und seltsames Grünzeug, was ist das, Tang? Irgendwelche Schlingpflanzen? Keine Ahnung. Türkische Imbisse, einer nach dem anderen, immer noch einer, Läden nur für türkisches Gebäck, Regalmeter um Regalmeter nichts als Kekse und Kuchen. Dann ein afghanisches Restaurant, ein indischer Laden, es gibt noch kein Restaurant mit syrischem Essen. Das wird aber sicher nicht mehr lange dauern, und die syrische Küche soll gut sein. Diese Straße ist wohl das, wovor die Demonstranten in Sachsen und anderswo solche Angst haben, diese Straße sieht nicht aus wie die durchschnittliche Einkaufsstraße in einer deutschen Kreisstadt. In dieser Straße kann man gut einkaufen.
Im Drogeriemarkt im Hauptbahnhof stehen drei vermutlich arabische Männer vor dem Regal mit den hundert Sorten Zahnpasta. Einer hält eine Packung in der Hand, die anderen sehen ihm über die Schulter, während er das Ding hin und her dreht und versucht, etwas darauf zu entziffern. Sie sprechen kein Englisch und kein Deutsch und kein Französisch, helfen kann ich ihnen nicht, wobei ich auf Französisch auch nur sinnlose Sätze wie etwa “es ist kalt heute” und “der Bahnhof ist groß” sagen könnte. Die Männer sehen auf die Packung, schütteln den Kopf, sie wissen nicht recht. Einer greift nach der nächsten Packung. Die ist genauso rätselhaft. Sie diskutieren leise, sie sehen alle Packungsseiten an, sie sehen sich an, sie kommen zu keinem Schluss. Es ist schwer. Alles ist schwer.
Für die diversen Hilfsgruppen in unserem kleinen Bahnhofsviertel kann man weiterhin spenden. Geld für eine heiße Suppe, für ein Nachtlager im Stadtteil, für etwas Versorgung der Menschen auf der Flucht.